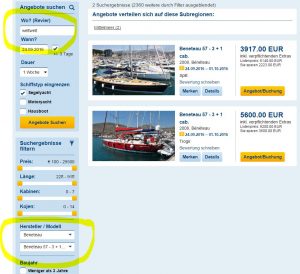Durch die Adria. Mit der Segelyacht durch die Schluchten der Krka.
Reisen kann man auf vielerlei Arten und mit unterschiedlichen Intentionen. Von Neugier getrieben immer wieder in neue, fremde Welten eintauchen, den kurzen Kick suchen, dem bielleicht irgendwann verstehen folgt. Oder immer wieder an dieselben Orte zurückkehren, weil sie eine „sichere Bank“ sind und sich die eigene Seele dort wohlfühlt, geheimnisvoll, wie auf einen Tastendruck, als wäre man in einem früheren Leben schon mal dort gewesen und kehrte nur wieder zurück, zu seinen Ursprüngen.
Die Krka, der große Fluss mitten in Kroatien, ist für mich so eine sichere Bank. Bin ich dort, muss ich hin, wieder und wieder, die Krka hinauf bis nach Skradin. Ich kenne den Ort, als ich kurz nach dem Balkankrieg dort hin kam, gab es dort wenig mehr zu sehen als die Einschusslöcher in den Hauswänden, als orthodoxe Serben und katholische Kroaten, die bis dahin friedlich am Ort zusammengelebt hatten, plötzlich aufeinander losgingen und die Messerverkäufer auf dem alljährlichen Jahrmarkt Hochkonjunktur hatten. Das ist nun fast 20 Jahre her, und auch wenn Skradin heute ein normales Touristenörtchen ist: Die Spuren des Krieges sind immer noch sichtbar. Doch davon zu anderer Zeit.
An die Krka reise ich, weil mich nach wochen-, ja monatelangem Salzwasser-Segeln, das Süßwasser immer wieder magisch anzieht. Auf einer Strecke von 18 Kilometern zieht sich der Fluss durch den Fjord, den er sich durch eine Felslandschaft grub, und es ist jedesmal spannend, dieses Stück den Fluss hinauf zurückzulegen bis zum Örtchen Skradin, wo man nicht weiterkommt, weil hier Wasserfälle die Weiterfahrt blockieren.
Die Fahrt selbst beginnt in Sibenik. Der Fluss selbst hat sich tief eingegraben, nur wenige Meter neben der grünen Fahrwasserbetonnung im Foto oben beträgt die Wassertiefe schon 17 Meter, zur Flußmitte hin dreißig Meter. Leicht mulmig ist einem dann doch immer irgendwie, dass nur ja der Motor durchhält und nicht gerade jetzt irgendwelche Zicken macht, obwohl man unter Genua auch segeln könnte, denn irgend ein Windchen weht da oben eigentlich immer. Durch zahlreiche Windungen und Kehren geht der Fluss hinauf, vorbei an größeren und kleineren Muschelfarmen, an
denen man anhalten und Venusmuscheln oder Austern kaufen kann. Es sind kleine Anlagen, die dort im Süsswasser der Krka Meeresmuscheln züchten. Obwohl das mit dem Süsswasser so eine Sache ist. Denn zu den Wundern der tiefschürfenden Krka gehört, dass oberflächlich zwar eiskaltes Süsswasser aus den Bergen strömt. Dass die Krka aber in zwei, drei Meter Wassertiefe eine Gegenströmung besitzt, die unergründlicherweise salzhaltiges Meerwasser 18, 20 Kilometer bis hinein ins Landesinnere nach Skradin zieht. Wer in der Krka badet, dessen Körper schwimmt im kalten Süsswasser, doch die Füße unten: Die stecken im warmen Meerwasser. Ein Kuriosum, das seinesgleichen sucht. Den Muscheln scheint es zu gefallen.
Keine zwei Stunden nach dem Ablegen in Sibenik erreicht man Skradin. Man kann in die Marina gehen, die wie es scheint jedes Jahr mehr und mehr um sich greift. Oder man kann etwas abseits am
anderen Flussufer in eine der Schilfbuchten gehen und dort seinen Anker fallen lassen. Es ist früher Abend geworden, als ich Skradin erreiche. Und ich ziehe die Schilfeinsamkeit dem Hafen vor, obwohl für die Nacht Gewitter angekündigt sind. Die Bora kann mächtig wehen in dem engen Flußtal. Aber die Aussicht, zu einem langen Schwimm einfach noch mal ins Wasser steigen und dem Einschlafen dem Rufen der Wasservögel und dem Rascheln im Schilf lauschen zu können, lässt mich den vermeintlichen Luxus der Marina schnell vergessen. Und morgen: Da gehe ich das eigentliche Geheimnis der Krka besuchen: Ihre Wasserfälle, die sich über 18 verschiedenen Kaskaden nach unten wälzen.
Gute Nacht also. Von LEVJE aus Schilfröhricht und dem Gezirpe des kleinen blauen Eisvogels.
Wenn Ihnen dieser Post gefiel:
Bitte unten Ihr Häkchen bei „Tolle Geschichte“ setzen.
Sie unterstützen diesen Blog, wenn Sie sich oben rechts mit eMail eintragen.
Dann bekommen Sie jeden neuen Post bei Erscheinen.
Gerne auch über FEEDLY oder BLOGLOVIN
Danke!
Mare Più: heißt „mehr Meer“.
Und wenn Sie mehr Geschichten
über die Menschen am Meer lesen wollen:
Wie es ist, auf einem kleinen Segelboot
• Italien
• Griechenland
• Türkei
zu bereisen. Und in fünf Monaten: Von München nach Antalya zu reisen.
Jetzt lesen. Als eBook. Als Print. Hier bestellen.
Auch als Film:
Sonntag, 16. Oktober 2016 20.15 Live im Kino
im Rahmen der Allgäuer Filmkunstwochen
im Filmhaus Huber, Bad Wörishofen.
Das sagt die Presse über Buch und Film:
„… ein Sehnsuchtsbuch par excellence.
Und ein echtes sinnliches Erlebnis.“
MÄRKISCHE ZEITUNG im Oktober 2015
„… eröffnet dem Weltenbummler ganz wunderbare Traumziele, auf die man
bei üblicher Herangehensweise schwerlich gekommen wäre.“
YACHT im Mai 2015
„Die Besonderheit des einstündigen Streifens ist seine Ruhe.
Eine Ruhe, die der Film mit poetisch angehauchter Sprache und sinnlichen Bildern von Szene zu Szene eingehender vermittelt.“
SEGELREPORTER im Dezember 2015
„… ein schönes, ein gelungenes Werk, animierend und inspirierend.“
LITERATURBOOT im Juli 2015
„Absolut empfehlenswert!
Für Reisebegeisterte ist ‚Einmal München-Antalya, bitte!‘ definitiv zu empfehlen.“
RATGEBER.REISE. im Juni 2015









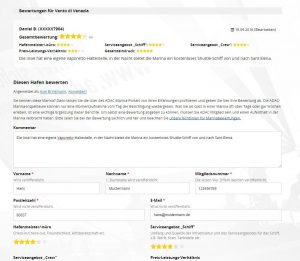 Der
Der