Philipp, 28, Hörer unseres Segelmythen-Podcasts SEGELN IST MEER! schrieb: Wie ist Segeln im Winterhalbjahr im Unterschied zum Sommer? In den vorigen Posts gab ich erste Einblick in die bestimmenden Faktoren Helligkeit/Dunkelheit sowie Herbstwetter. Ich beschrieb meinen Allerheiligen ud Allerseelen auf See, doch der 3. Tag sollte alles toppen, was ich bisher auf See erlebt hatte…

Die meisten Menschen, die seit April an meinen Mittelmeer- und Kroatien-Wetter-Webinaren teilgenommen haben, kommen mit einer Frage im Kopf. „Was ist der beste Wetterbericht? Welches Wettermodell liefert mir den treffendsten Vorhersagen?“ Die Frage ist nicht falsch. Sie ist nur nicht zielführend. Sie ist eine Scheinfrage und führt zu Schein-Antworten, wie so vieles, worüber wir im Augenblick diskutieren. Sie ist nicht falsch, sie bringt nur niemanden weiter.
Ich beantworte diese Frage stets so: „Es kommt nicht auf den Wetterbericht an. Es kommt viel mehr auf dich an. Weißt du genau, was du zu tun hast, WENN es so kommt, wie der Wetterbericht sagt?“ Ich frage mich seit Donnerstag, ob ich das denn jederzeit weiß? Diese Frage klingt bis heute nach.

Der kroatische Wetterbericht las sich nicht schlecht für diesen ersten November-Donnerstag und nicht anders als WINDY oder PREDICTWIND, das sechs verschiedene Wettermodelle gegenüberstellt. Selbst wenn ich das pessimistischste Modell zugrunde legen würde (wie üblich für Kroatien das britische Wettermodell UKMO ;-)), gäbe es
– Donnerstag Vormittag Südwest 20-24 Knoten, also beherrschbar.
– Ab Mittag drehend auf Süd 24-26 Knoten.
– Erst lange nach Einbruch der Dunkelheit Süd 33-40 Knoten. Aber um diese Uhrzeit wäre ich ja längst im Hafen. Das Wetterfenster würde mir locker reichen, ich würde spätestens Mittag irgendwo im Hafen sein. Ich sah den Wetterbericht. Ich sah nicht, dass die Wellen an diesem Tag so stark sein würden, dass sie am Nachmittag in Piran, wo ich hin wollte, meterdicke Felsblöcke aus dem Wellenbrecher an Land kugeln würden, als wären es Murmeln.

Pirans Riva, die Südpromenade am Spätnachmittag des 2. November. Auf ganzer Länge würde Gestein aus dem Meer Richtung Restaurants gewaschen. Etwa 2 Stunden vor der Aufnahme war ich im dicksten Sauwetter etwa eine Seemeile daran vorbeigesegelt.
Um 7 Uhr morgens startete ich nach einer unruhigen Nacht in einer Bucht vor den Brioni-Inseln den Motor, holte den Anker nach oben, und setzte Vollzeug. In der Bucht war es ruhig, genau wie die PREDICT-Wind das angegeben hatten. Um 7.10 Uhr stellte ich den Motor ab, wir glitten unter Vollzeug nordwärts aus dem Schutz des Fazanski-Kanals nach Norden Richtung Rovinj.
Um 9.50 Uhr hatte ich Südost 6+, also deutlich mehr und etwa das, was die Modelle für den Nachmittag prognostiziert hatten. Ich tat, was man halt tun muss. Reffen. Was sonst. Also jeweils 1. Reff in Großsegel und in Genua. Das passt so für Levje’s Segeltragezahl, die eher klein ist.
Eineinhalb Stunden später, gegen 11.50 Uhr wurde der Wind sehr böig, die Wellen steilten auf und warfen Levje nun regelmäßig aus der Bahn, wenn sie von achtern unter uns durchgingen. Eine gerade Kurslinie zu halten, war nun nicht mehr möglich. Um eine Patenthalse zu vermeiden, drehte ich kurz bei und nahm das Großsegel weg. Also weiter nur unter der gerefften Genua. Passt schon.

Gegen 12.30, irgendwo zwischen Rovinj und Umag, notierte ich im Logbuch: „Südost konstant 30-35 Knoten.“ Ich fuhr platt vor dem Wind. Seit zwei Stunden standen ich nun selber am Steuer und kurbelte wie ein Wilder, damit Levje nicht ausbrach, sobald eine Welle unter uns durchging. Und ich versuchte, exakt die 30 Meter Tiefenlinie zu halten, weil ich beobachten konnte, wie die Wellen in Richtung Ufer deutlich schneller brachen als draußen auf See. Die 30-Meter-Linie, das war mein Garant. Ich war in Irland schon einmal bei eine Südwest-Starkwind in den Kilometer breiten Mündungstrichter des River Suir eingelaufen und hatte erlebt, dass selbst das nicht reicht. Eine von achtern durchgehende Welle war auf über 30 Meter Wassertiefe unter uns durch und hatte uns trotz Segel und Motor so herumgeschleudert, dass mein Topf mit Suppe vom kardanisch aufgehängten Herd quer durch den Salon noch vorne ins Vorschiff knallte. Brechende Seen: Sie sind die eigentliche Gefahr bei diesem Wetter.
Novigrad kam in Sicht. Ich dachte kurz darüber nach, ob ich den Hafen anlaufen sollte. Er wäre geschützt, wenn ich einmal drin wäre. Aber ich verwarf den Gedanken. Der Wind weht mittlerweile aus Süd und damit auflandig auf die nach Nordnordwest laufende Küste. Die Hafeneinfahrt war 10 Meter tief. Aber der Blick seitwärts auf die brechenden Wellen sagte mir, das lieber bleiben zu lassen. Eine einzige brechende See in der Einfahrt, die ich durch meine Kurbelei am Ruderrad nicht mehr würde aussteuern können, würde uns einfach wegwaschen, wenn es dumm liefe. Also weiter.

Weiter am Ruderrad stehen. Weiter kurbeln. Weiter versuchen, die Wellen von achtern auszusteuern, weil ich genau nach Nordnordwesten musste. Hinauf, wo zwei Stunden entfernt Kap Savudria lag und die Küste nach Osten Richtung Triest zurückspringen würde. Wäre ich erst um Piran herum, wäre alles vorbei. Dachte ich jedenfalls.
Um 13.15 Uhr bewegt sich der Wind fast konstant zwischen 30 und 40 Knoten. Das Meer legte sich in schaumige Streifen, die anzeigen, dass ich jetzt in Windstärke 7 unterwegs war. Ich hatte jetzt das 2. Reff in der Genua – also würde ich jetzt das dritte Reff einbinden müssen. Aber so, wie ich das immer machte, würde das nicht funktionieren bei der Windstärke. „Bau jetzt bloß keinen Scheiß!“ Denn wenn ich einfach loswürfe, würden sich im Nu die Schoten vertörnen. Das Segel würde ungeheuer Schlagen und könnte allein durch die unkontrollierte Bewegung einreissen. „Ten Seconds for ten Minutes“, das habe ich aus meinen Gesprächen mit den Bergrettern gelernt. Ich dachte nach, wie ich reffen könnte, ohne mein Vorsegel zu beschädigen. Ich ging von meinem vorlichen Kurs etwa 30 Grad in den Wind. Hielt hinaus, weg vom Land auf die offenen See. Fierte die Genuaschot so viel, dass gerade noch Spannung im Segel war und das Boot Kurs hielt. Und rollte dabei vorsichtig per Reffleine die Genua Stück für Stück ein. Es klappte.

Um 14 Uhr kam Kap Savudrija voraus ins Sicht. Der Wind überschritt nun regelmäßig die 40-Knoten-Grenze. Nein, ich war alles andere als cool. Ich fragte mich seit zwei Stunden, wie ich es bei den Wellen schaffen sollte, soweit nach Norden zu kommen. Es ging nicht anders, die Häfen im Osten waren mir versperrt. Ich war längst darüber hinaus, das Gefühl zu haben, ich könnte irgendwas beeinflussen, hätte irgendetwas unter Kontrolle. Alles was ich tun konnte, war selber am Steuer zu stehen und wie ein Blöder am Rad zu kurbeln, wenn uns wieder irgendweine blöde Welle von achtern wie ein Spielzeug aus dem Kurs warf.
Um Savudrija musst ich jetzt rum. Aber es war, als würden die Wellen spüren, dass es flacher wurde. Sie brachen jetzt häufiger. Eine detonnierte mit einem lauten Knall genau in unserem Heck und wusch 5 Eimer Seewasser von hinten ins Cockpit. Ich hatte noch keine Zeit gehabt für meine Schwerwetterhose, macht nichts, jetzt ist halt die Hose nass, aber hej, es ist doch klasse! Der Jugo ist doch warm.
Wie man gegen die Angst vorgeht? Sarkasmus hilft, genau wie dieser. Selbstgespräche helfen. Ich bin ja allein an Bord, also kann ich nur mit mir reden. Und das ist bei Angst keinesfalls die schlechteste Methode. Um gegen meine Angst vorzugehen, und weiter voll konzentriert am Rad zu bleiben, packte ich aus, was ich an Mitteln und Methoden wusste. Alles, was ich bisher getan hatte, meine Bücher mit Bergrettern und Seenotrettern, meine Übersetzung des Buches STURMTAKTIK, alles hatte irgendwie kleinste Spuren in mir hinterlassen, die mir jetzt weiterhalfen.
Ich erzähle nun nicht mehr, dass ich mir eine Stunde Zeit ließ, um in weitem Abstand Kap Savudrija zu runden. Dass ich versuchte, auf der dreißig Meter-Linie zu bleiben, um nicht in die brechenden Seen vor dem Kap zu geraten. Ich erzähle nicht, dass dort, wo ich gedacht hatte, ich wäre da endlich rum um die Ecke der Starkregen einsetzte, gerade so, um mir alle Sicht zu nehmen.
Um 15.20 Uhr erreichte ich den Hafen von Izola, meinem langjährigen Heimathafen mit meiner früheren Levje. Ich wusste, auch dort würde der Süd hart wehen. Aber er käme von den Hügeln herunter und aus dem Hafen heraus statt auflandig darauf zu.
Wäre ich, wenn ich all das gewusst hätte, nicht losgesegelt? Ich weiß es nicht. Wir Menschen sind dazu verdammt, zu lernen. „Research? Ist immer Me-Search“. Ich habe so viel neues gelernt für mich in dieser Situation. Dinge wie
„Warum es leichter ist bei 7 Beaufort zu steuern als bei 6 Beaufort, aber weitaus tückischer.“
Wie ich anders reffe.
Wie ich beidrehe, um richtig beizuliegen.
Ich habe gelernt, welche Mittel es gegen die eigene Angst gibt. Wie ich, der ich kein mutiger Mensch bin, weiter funktioniere, wenn es darauf ankommt.
Ich habe gelernt, was ich nicht mehr lernen musste: Dass Levje, mein Schiff weit besser ist als sein Skipper.
Um alle diese Erfahrungen drehen sich meine kommenden Online-Seminare: WETTER IN KROATIEN am 9. November und in mein STARKWIND-Webinar am 30. November.
Im nächsten Post: Izola. Bei Sturm ist der Hafen ein sicherer Ort?


 Die Biscaya liegt jedem Segler quer im Magen, der, aus dem Norden kommend, nach Sonne und Wärme hechelt. Ein wenig vergleichbar mit der Chinesischen Mauer, die man zu überqueren hat, ohne zu wissen, was einen erwartet, bevor man nicht mitten drin im Abenteuer ist.
Die Biscaya liegt jedem Segler quer im Magen, der, aus dem Norden kommend, nach Sonne und Wärme hechelt. Ein wenig vergleichbar mit der Chinesischen Mauer, die man zu überqueren hat, ohne zu wissen, was einen erwartet, bevor man nicht mitten drin im Abenteuer ist. 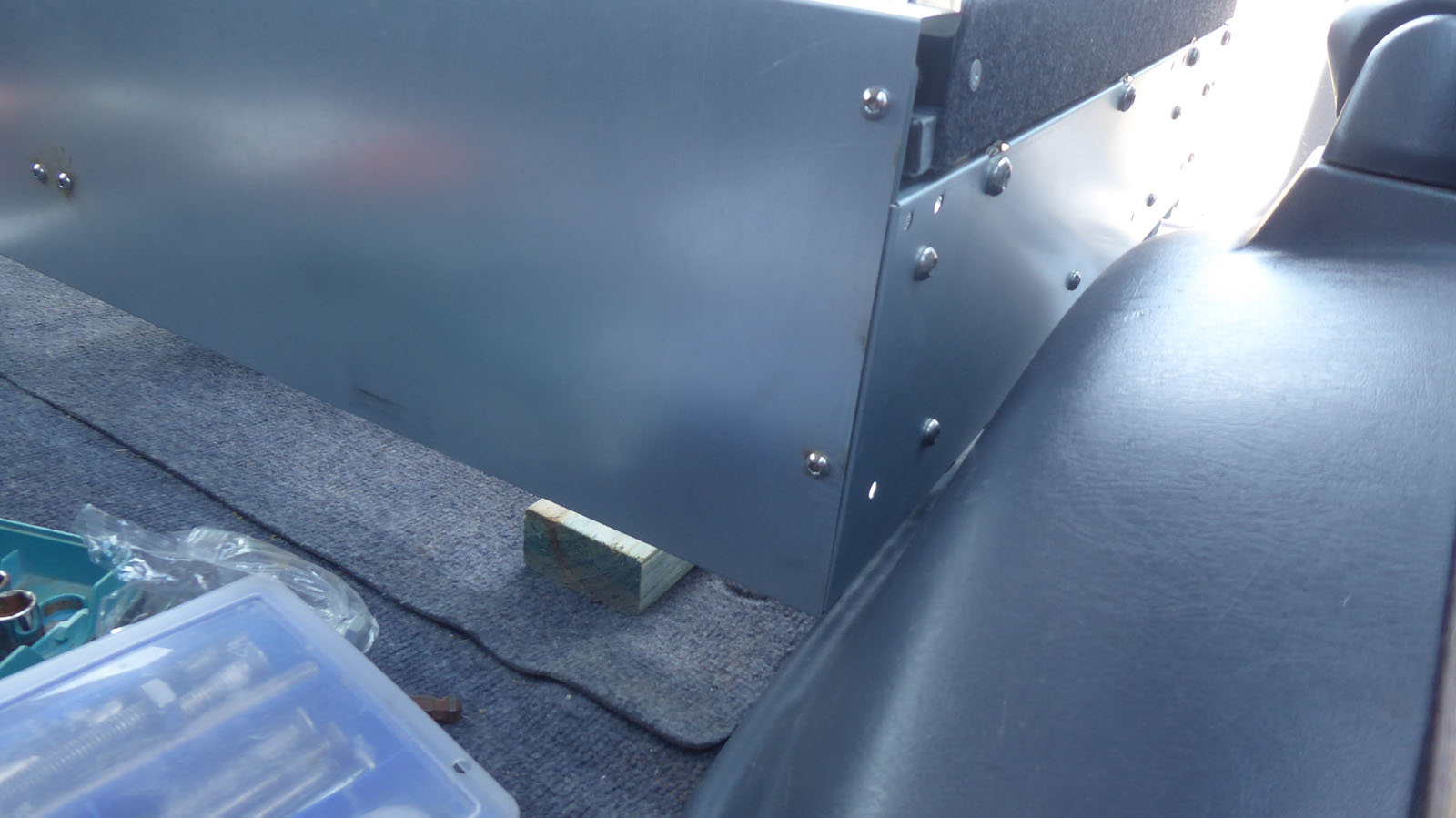























 The Windpilot arrived in good shape. I’m impressed with its robustness. The castings/machining work is first class. Also, nice job with the literature paper stock. Good quality. Nothing worse than cheap photo copies. Thanks for the book !!!
The Windpilot arrived in good shape. I’m impressed with its robustness. The castings/machining work is first class. Also, nice job with the literature paper stock. Good quality. Nothing worse than cheap photo copies. Thanks for the book !!! Hallo Herr Förthmann, der Törn mit der Malu lief hervorragend, auch dank Ihres Windpiloten. Wir haben viel erkundet, dabei gar nicht so grosse Sprünge gemacht, und haben das Boot dann in Brest an Land gestellt.
Hallo Herr Förthmann, der Törn mit der Malu lief hervorragend, auch dank Ihres Windpiloten. Wir haben viel erkundet, dabei gar nicht so grosse Sprünge gemacht, und haben das Boot dann in Brest an Land gestellt. Wir hoffen, dass es in 2024 weiter geht mit der Reise. Wir werden berichten.
Wir hoffen, dass es in 2024 weiter geht mit der Reise. Wir werden berichten. Die Bretagne haben wir weitgehend ausgelassen: Es wehte beständig aus Nordost, sodass wir westwärts die englische Küste gesegelt sind und dann von den Scilly Islands via L’Ouessant nach Brest.
Die Bretagne haben wir weitgehend ausgelassen: Es wehte beständig aus Nordost, sodass wir westwärts die englische Küste gesegelt sind und dann von den Scilly Islands via L’Ouessant nach Brest.  Nein, weder Wilfried Krusekopf noch meine Wenigkeit, leiden unter Langeweile. Wir schneiden keine Rosen, oder bügeln träge Hemden oder Unterhosen, sondern reihen jeden Tag gutgelaunt an den nächsten, wie wir es seit Jahrzehnten halten: wir tun genau das, was wir am besten können: Tage als Perlenkette, erfüllt mit unseren Herzensangelegenheiten, die zu unserem Lebensmittelpunkt geworden, wie Sonne Mond und Sterne – gerne. Wir arbeiten, segeln und schreiben für Segler, die unsere Hilfe nachfragen, bzw. sogar kaufen, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen, ganz ohne rot zu werden. Wir sind mit uns im Reinen und Arbeit unser Vergnügen. Und dann passiert manchmal unverhofft, was sich vor kurzem abgespielt:
Nein, weder Wilfried Krusekopf noch meine Wenigkeit, leiden unter Langeweile. Wir schneiden keine Rosen, oder bügeln träge Hemden oder Unterhosen, sondern reihen jeden Tag gutgelaunt an den nächsten, wie wir es seit Jahrzehnten halten: wir tun genau das, was wir am besten können: Tage als Perlenkette, erfüllt mit unseren Herzensangelegenheiten, die zu unserem Lebensmittelpunkt geworden, wie Sonne Mond und Sterne – gerne. Wir arbeiten, segeln und schreiben für Segler, die unsere Hilfe nachfragen, bzw. sogar kaufen, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen, ganz ohne rot zu werden. Wir sind mit uns im Reinen und Arbeit unser Vergnügen. Und dann passiert manchmal unverhofft, was sich vor kurzem abgespielt: Dies ist eine kleine Geschichte, wie zwei Männern sich Flügel angeschraubt, um als Schutzengel verkleidet, einer jungen Seglerin ein wenig Unterstützung zu gewähren, sie vor Unheil zu bewahren um ihre ersten Erfahrungen auf See ins Positive zu wenden, indem wir sie virtuell ein wenig schubsen und begleiten.
Dies ist eine kleine Geschichte, wie zwei Männern sich Flügel angeschraubt, um als Schutzengel verkleidet, einer jungen Seglerin ein wenig Unterstützung zu gewähren, sie vor Unheil zu bewahren um ihre ersten Erfahrungen auf See ins Positive zu wenden, indem wir sie virtuell ein wenig schubsen und begleiten.  Luca gedachte nach ihrem Studienabschluss ein Sabbatjahr einzuschieben, darum ging es von Berlin nach Hamburg mit aller Macht. In Wedel wurde die Palme auf´s Schiff gebracht, dann noch kurz die Crossbar abgeholt. Die Zeit drängte, man wollte weg, gen Süden. Gran Canaria das erste Etappenziel. Zwei junge Damen mit Mumm und Power, denn die Eignerin hatte eine Freundin mit an Bord. Start in Wedel: 12.09.2023 bei ablaufender Tide, so war das gedacht und so wurde es dann gemacht.
Luca gedachte nach ihrem Studienabschluss ein Sabbatjahr einzuschieben, darum ging es von Berlin nach Hamburg mit aller Macht. In Wedel wurde die Palme auf´s Schiff gebracht, dann noch kurz die Crossbar abgeholt. Die Zeit drängte, man wollte weg, gen Süden. Gran Canaria das erste Etappenziel. Zwei junge Damen mit Mumm und Power, denn die Eignerin hatte eine Freundin mit an Bord. Start in Wedel: 12.09.2023 bei ablaufender Tide, so war das gedacht und so wurde es dann gemacht. Warten auf ein Wetterfenster kann auf Vlieland langweilig werden, jedenfalls im Herbst, da hilft dann ein schneller Hinweis auf die Staande Mastroute, um ein wenig Sightseeing in A´dam mit sicheren Tagen im Landschutz zu unternehmen, gleichwohl trotzdem Meilen gut zu machen, um sodann bei Ijmuiden wieder auf der Nordsee mitzuspielen. So vergingen die Tage. Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Cherbourg, die Jambalaya ist flott vorangekommen. In Cherbourg allerdings habe ich die Damen auf Wilfried verwiesen, der ihnen die Feinheiten seines Hausrevier in Wort und Schrift vor Augen geführt, um sicherzustellen, dass eine kleine Bianca ohne Kratzer oder Dellen in Rumpf und Seele die Bretagne auf dem Weg nach Süden passieren kann. Eine kleine Rundfahrt um Alderney herum, dann wurde Kurs auf Roscoff abgesetzt. Die Luft war günstig, denn sie ist stehengeblieben, die Biscaya hatte sich zum Schlafen flach gelegt. Das war die grosse Chance, mit Hilfe einiger Reserve Kanister bis nach Spanien zu gelangen, der Motor noch neu, hat keine Zicken gemacht.
Warten auf ein Wetterfenster kann auf Vlieland langweilig werden, jedenfalls im Herbst, da hilft dann ein schneller Hinweis auf die Staande Mastroute, um ein wenig Sightseeing in A´dam mit sicheren Tagen im Landschutz zu unternehmen, gleichwohl trotzdem Meilen gut zu machen, um sodann bei Ijmuiden wieder auf der Nordsee mitzuspielen. So vergingen die Tage. Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Cherbourg, die Jambalaya ist flott vorangekommen. In Cherbourg allerdings habe ich die Damen auf Wilfried verwiesen, der ihnen die Feinheiten seines Hausrevier in Wort und Schrift vor Augen geführt, um sicherzustellen, dass eine kleine Bianca ohne Kratzer oder Dellen in Rumpf und Seele die Bretagne auf dem Weg nach Süden passieren kann. Eine kleine Rundfahrt um Alderney herum, dann wurde Kurs auf Roscoff abgesetzt. Die Luft war günstig, denn sie ist stehengeblieben, die Biscaya hatte sich zum Schlafen flach gelegt. Das war die grosse Chance, mit Hilfe einiger Reserve Kanister bis nach Spanien zu gelangen, der Motor noch neu, hat keine Zicken gemacht.
 Wenig später am gleichen Tage dann Wilfried:
Wenig später am gleichen Tage dann Wilfried: Zwischen den harten Winden ist die Jambalaya bis nach Figueira da Foz vorgerückt, wo die Damen die harten Fronten abgesessen haben. Heute nun sind sie dort ausgelaufen, um weiter nach Süden zu kommen.
Zwischen den harten Winden ist die Jambalaya bis nach Figueira da Foz vorgerückt, wo die Damen die harten Fronten abgesessen haben. Heute nun sind sie dort ausgelaufen, um weiter nach Süden zu kommen.





