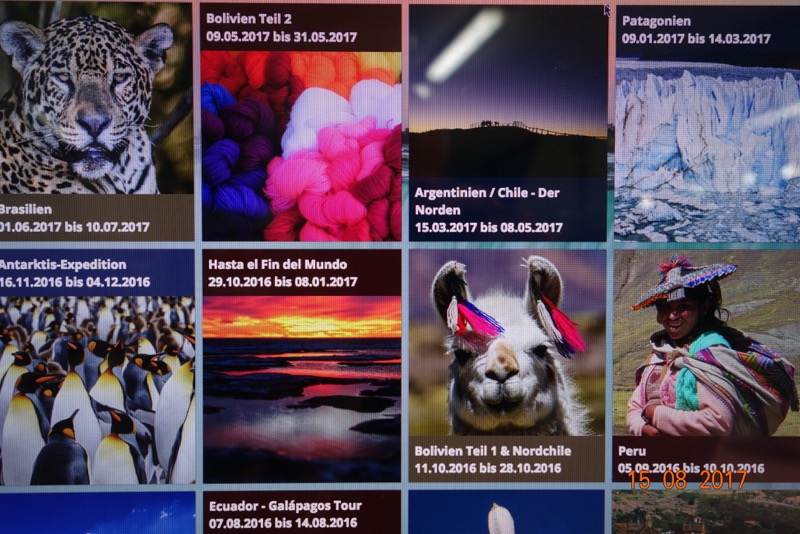Am Ende des gleichnamigen langgestreckten Golfs, in seinem hintersten Winkel der langgestreckten Bucht, die eigentlich ein Fjord ist, liegt die Stadt Kotor. Wie ein Kranz überragt die Wehrmauer die alte Stadt. Wer sie besucht, der kann die 1.200 Stufen die alte Stadtmauer hinaufsteigen. Und in drei Stunden auf einen der Gipfel des Lovcen-Gebirgsmassivs wandern, das sich gleich hinter Kotor von von 0 auf über 1.700 Meter steil erhebt.

Also mache ich mich am frühen Morgen auf und rudere von meinem Ankerplatz hinüber zur Stadt. Es ist die beste Zeit. Die Stadt liegt noch im Schatten des großen Berges. Es ist noch nicht heiß. Ich habe mir die Kameras und zwei Flaschen Wasser in meinen Rucksack gepackt.
Irgendwo in einer Seitengasse der kleinen Altstadt geht es rechts ab. Zur Stadtmauer. Man zahlt drei Euro: Und schon darf man hinauf, die Stadtmauer entlang, die zu errichten mindestens sechs Jahrhunderte notwendig war.

Dass es tatsächlich 1.200 Stufen sind, erfahre ich von Marco. Er weiß solche Dinge – schließlich ist er der Küster des kleinen Kirchleins, das auf halber Höhe und halbem Weg in die Wehrmauer eingebettet ist. Marco steht jeden Morgen um sechs auf und geht hinauf zur Kirche. Die Stufen bis zu seiner Kirche hat er nie gezählt. Er läutet da oben über der Stadt die Glocke, wenn es Zeit ist. Verkauft Heiligenbildchen, Anhänger oder – so wie mir – zwei Kerzen, um sie am Altar anzuzünden. Während ich mit ihm spreche über dies und das, während die Hitze steigt und das Innere der Kirche wie einen Backofen füllt, frage ich mich, wie das Tun eines Menschen sein Gesicht formt.
Ob Marco schon als kleiner Junge aussah wie ein gütiger Mönch? Ob sein Gesicht erst so wurde, weil er tagein, tagaus eben nichts anderes tut als seinen Dienst in der kleinen Kirchen zu versehen?
Ist es unser Gesicht, das uns irgendwie an den richtigen Fleck im Leben stellt, an den wir hingehören? Oder ist unser Gesicht nur Spiegel dessen, was wir Denken, Tun? Das Gemälde dessen, was unser Leben ist? Worin wir unser Glück finden?

Die Kirche selbst war die gefühlt 300 Stufen alleine schon wert. Weil sie hübsch ist in ihrem Inneren, und einfach, und beides eben doch auch wieder nicht. In manchen Details könnte der Amerikaner Jeff Koons sie designt haben, nein, nicht mit dem Barock-Altar. Der kann mit seinen Stein-Intarsien und den beiden Heiligen zwischen den Säulen seine Herkunft aus Venedig nicht leugnen. Jeff Koons aber könnte Schöpfer der türkis hinterlegten Marien-Abbildungen, der Puti, und von mancherlei geschwungenem Zierat an den Wänden sein.

Wie so oft, wohnt Einfachheit an diesem alten Ort. Irgendetwas, das mich Ruhe finden lässt selbst in der feuchten Hitze seiner Mauern. Gleichmaß, Symmetrie im Steinboden, in der einfachen Kirchenbank, im kleinen Treppenhaus, das nach oben zur Empore führt. Ein beruhigendes Gleichmaß, das mir immer wieder in alten Bauten wie diesen begegnet. Und zu selten sonst in der Welt. Würde man heute diesen Raum irgendwo nachbauen, exakt eins zu eins: Er besäße alles, was der Raum dieser Marienkirche besitzt. Nur das eine nicht. Die Schönheit, die nur Jahrhunderte und ihre Spuren in einen Raum bringen können.
Ich verlasse Marco, den Küster, und wandere weiter hinauf, die Stufen der alten Wehrmauer entlang, bis ich am höchsten Punkt stehe, da, wo die Wehrmauer den Gipfel erreicht und das Fort von San Giovanni steht. Und wo man den Gipfeln des Lovcen schon merklich nahe ist.

Zu den beliebten und stets neu zu klärenden Fragen im Leben gehört: Käme man als Tier auf die Welt – als was würde man sich gerne inkarnieren? Könnten Sie es aus dem Stand heraus benennen? Ich wusste. Nichts anderes als eine Dohle. Hier oben, wo es einsam wird zwischen den steilen Wänden, da treffe ich sie, die mich oft auf Wanderungen begleiteten. Wo immer ich sie traf, ob in Südfrankreich oder England, wohnten sie am liebsten nahe altem Gemäuer. In der Nähe von Burgen, von einsam gelegenen Mauern und Festungen. Manchmal erschienen mir die kleinen Krähenvögel schon wie Menschen, die einst an diesem Ort gelebt hatten – und einfach nicht weggehen konnten, auf der Suche nach irgendetwas. Ich liebe ihren Flug. Mit leise krächzenden Lauten und lässig hängenden Füßen kurven sie schwerelos zwischen Felswänden umher.

Noch ein Blick auf die Stadt von oben. Dann führt ein schmales Loch in der Mauer nach draußen. Ein Schild sagt, dass es von hier aus noch zwei Stunden sind, bis zum nächsten Gipfel des Lovcen. Hinter dem Loch in der Mauer geht es über ein paar Felsen hinunter. Dann stehe ich vor der nächsten Schönheit am Wegrand.

Die verlassene Kirche eines Dorfes zwischen verfallenden Gebäuden. Es ist nicht mehr als eine Kapelle. Das Dorf, das sich in die Senke duckt, kann nicht groß gewesen sein. Jetzt ist die Kapelle leer. Ein paar Pferdeäpfel liegen zwischen den Trümmern am Boden, aber noch ist das Gewölbe der Kapelle bemalt. Noch zeigt die abblätternde Farbe dort oben jene wunderbaren Blautöne, die sie einst zum Leuchten brachten.

Dann wird es anstrengend. In langen Zickzack-Linien führt der Weg nach oben. Er ist verblüffend gut ausgebaut – vermutlich waren es die österreich-ungarischen Matrosen, die den Weg militärisch befestigten. Waren an der alten Stadtmauer noch viele unterwegs: Jetzt ist es fast einsam. Nacheinander begegnen mir:
1. Ein junger Mann in Turnschuhen, der erst den Berg hinaufjoggt. Und dann mit langen Schritten trittsicher zwischen den Steinbrocken hinunterspurtet. Training für den nächsten Lovcen-Marathonlauf.
2. Eine Gruppe Chinesinnen und Chinesen, angeführt von einem heimischen Führer, der sein Gesicht zum Schutz vor der Hitze dick mit Creme eingeschmiert hat. Und mich fragt: Ob ich denn auch genug Wasser dabeihätte? Glücklich sehen sie hier oben nicht aus, die Chinesen.

3. Einen Mann, der hinter seinem vollbepackten Esel Richtung Gipfel trottet. Man sieht ihn etwa in der Bildmitte oben. Hinter dem Esel. Vielleicht einer, der die einsam gelegenen Höfe dort oben mit dem Nötigsten versorgt? Auch er trägt Turnschuhe. Weil sie ihm zu groß sind, benutzt er sie als Pantoffeln, deren hinteren Teil er einfach plattgetreten hat. Trittsicher folgt er über das Geröll seinem Esel, der leidend, doch selbstbewusst seinen Weg kennt.

Wie ein Lichterkranz umgibt die Stadtmauer das alte Kotor in der Nacht. Und weil die Lichterkette sich an diesem windstillen Abend im Wasser der Bucht von Kotor spiegelt und die Spiegelung aussieht: Als wäre sie nichts anderes als ein leuchtendes Herz in der Nacht, drum endet mit diesem Foto für meine Frau dieser viel zu lange Post. Über eine Wanderung. Und die nie enden wollende Suche nach dem Glück.