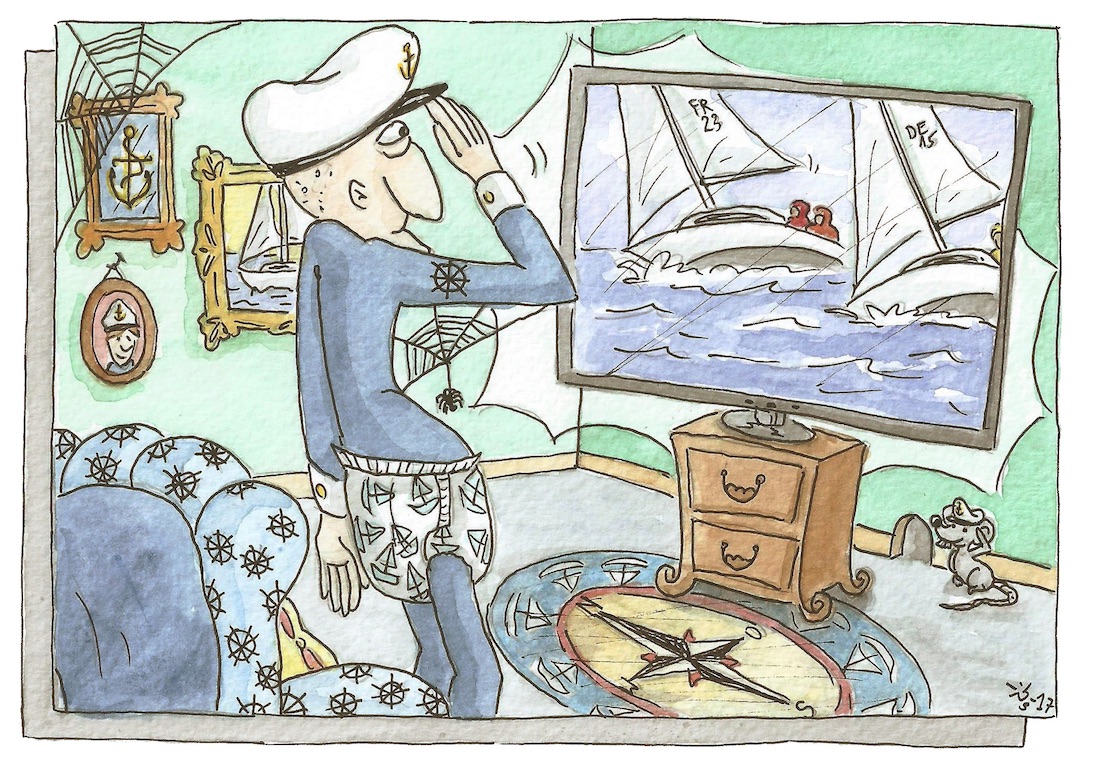Warten auf das Fährschiff in Kiel.
Unberührte Natur, schroffe Felslandschaften, Fjorde und Kälte. Das ist es, was Menschen häufig mit Norwegen assoziieren. Manchmal fällt einem vielleicht noch der erste Platz im „Human Development Index“ ein.
Sabrina und ich wollten seit langer Zeit wissen, wie es wirklich in Norwegen und dem nördlichen Teil Schwedens ist. Seit mehr als 2 Jahren hatten wir versucht, eine Reise zu organisieren, wurden jedoch immer wieder durch diverse Einschränkungen der Covid-19 Problematik daran gehindert.
In diesem Frühling waren Reisen ohne Einschränkungen, vor allem bei der Rückkehr nach Deutschland, endlich wieder möglich. Schweden und Norwegen hatten ohnehin einen etwas anderen Kurs beim Umgang mit dem Virus gewählt und so mussten wir uns in den ersten zwei Tagen ein wenig an die neue (alte) Freiheit ohne Masken, Abstände, Desinfektion und das Händeschütteln gewöhnen.
Wir sind am 2. April in Wesel gestartet und waren 450km später am Schwedenkai in Kiel. Dort ging es für den Subaru aufs Fahrzeugdeck und für uns in eine sogenannte Haustierkabine. Die Fähre von Stena Line ist eine von wenigen, bei denen Hunde mit in die Kabine genommen werden dürfen. Das Ganze hat natürlich seinen Preis, aber für uns bedeutete die Schiffsreise von Kiel nach Göteborg einen entspannten Start und wir waren am nächsten Morgen gut ausgeschlafen in Schweden und konnten die erste lange Etappe nach Norden in Angriff nehmen.

Kurz vor dem Anlegen in Göteborg.
Auf den Korridoren an Bord der Stena Scandinavica haben wir noch aus Gewohnheit die FFP2 Maske getragen und Menschenansammlungen gemieden. Teilweise wurden wir erstaunt beäugt und kamen uns irgendwie fehl am Platz vor. Bis auf zwei weitere Familien aus Deutschland, die am nächsten Morgen ebenfalls noch brav mit Maske zum Frühstück getigert sind, waren wir die einzigen. Für Schweden und Norweger war Corona sprichwörtlich schon lange gegessen. Man hatte vieles anders gemacht und sich mit dem Virus engagiert. Ob das besser oder schlechter war oder ist, will ich nicht bewerten. Darum dürfte vermutlich noch Jahre gestritten werden und mich interessiert dieser Streit nicht.
Was wir jedoch sofort festgestellt haben war, dass wir das offenere Miteinander, die Mimik, den direkteren Kontakt durchaus vermisst haben.
Morgens um kurz nach 9 Uhr war das Schiff am Kai in Göteborg fest und ein paar Minuten später saßen wir im Auto.
Beim Zoll wurde nur kurz ein Blick auf Filou geworfen, seine Papiere und die Impfungen gecheckt. Wir hatten bereits unsere Covid-19 Impfzertifikate bereitgelegt, aber das hat niemanden interessiert. Hauptsache der Hund ist angemeldet.
Und so fuhren wir entspannt raus aus der Stadt und waren, 15 Jahre nach unserem letzten Besuch in Schweden, wieder auf der E 45 nach Nordwesten unterwegs.

Unterwegs in Südschweden.
Gott, ist das lange her!
Damals sind wir mit unserem kleinen, blauen Twingo bis zum Vänern gefahren und haben dort gezeltet. Wir waren ziemlich schlecht vorbereitet, hatten unnötig viel Gerümpel mit dabei und waren knapp bei Kasse. Aber es war ein feiner, kleiner Abenteuerurlaub, mit vielen Mücken und viel Regen. Die Fahrt bis zum Vänern kam uns damals vor, wie eine kleine Weltreise.
Am 3. April 2022 gegen Mittag lag der Vänern, der größte See Schwedens, bereits südlich von uns und wir waren nach dem Linksabbiegen in Grums, am eigentlichen Start unserer Reise in den hohen Norden. Etwa 1.600km Landstraße lagen nun vor uns, die wir grob in 2 Tagesetappen eingeteilt hatten. Einen fixen Plan gab es ab hier nicht mehr. Wir wollten so lange fahren, wie es für uns und den Subaru ok war und dann nach einer Übernachtungsmöglichkeit Ausschau halten.

Auf der E45 nach Norden.
Für diese langen Etappen war der CD-Wechsler vollgepackt mit bestem Stoff aus den letzten 6 Jahrzehnten und unsere Nintendo Konsolen lagen bereit. Um es vorweg zu nehmen, wir haben es bis zum Ende des Urlaubs nicht geschafft, alle CDs zu hören und es wurde nicht ein einziges Mal mit den Konsolen gezockt!
Was uns die E45 geboten hat, war mehr als genug Unterhaltung. Atemberaubende Landschaft, kleine Städtchen im Nirgendwo und ein Gefühl, ewig unterwegs sein zu wollen. So wie hier, sind wir noch nie gefahren. Oft fährt man 80km/h, manchmal ist auch 90 oder 100 erlaubt. Die Straße schlängelt sich in einer nie enden wollenden Abfolge von Kurven durch die Landschaft und bei jeder Pause die wir einlegen, wird es kälter beim aussteigen.
Der Tag vergeht fast wie im Flug, obwohl wir am späten Abend feststellen, dass wir bereits 13 Stunden unterwegs sind. So langsam wird es aber dunkel und an diesem Abend begreifen wir zum ersten Mal, warum uns auf der E45 so viele Autos mit Zusatzscheinwerfern entgegen kommen. Am Mittag hatten wir noch darüber geschmunzelt und Späße gemacht. Klar kannten wir die schwedischen Autos mit den riesigen runden Glubschaugen vor dem Kühlergrill, von Fotos und aus Dokus. Wir hatten es als Eigenart abgetan, wegen der langen Dunkelheit im Winter, als etwas das sich hier entwickelt hat, weil es ganz nett ist. Vielleicht auch als etwas, dass hier als ästhetisch empfunden wird.
An diesem ersten mondlosen Abend auf der E45 im Niemandsland, werden wir eines besseren belehrt. Wie es sich anfühlt, hier oben im Dunkeln zu fahren, kann man sich am besten so vorstellen, wie mit einem Teelicht nachts durch den Wald zu wandern.
Warum das so ist, liegt an mehreren Umständen, die im Ergebnis dazu führen, dass man kaum etwas sieht. Die Straße ist zum einen deutlich schmaler als deutsche Landstraßen. Reflektierende Seiten- oder Mittelmarkierung gibt es manchmal keine, oder sie sind abgefahren. Begrenzungspfähle fehlen häufig. Der Asphalt ist Abschnittsweise nicht grau, sondern dunkelbraun. Dieser Asphalt reflektiert sichtbar weniger Licht und der Kontrast zum braunen Straßenrand ist gering.
Der letzte und vielleicht krasseste Unterschied ist das fehlende Streulicht. Dort wo der schwache Scheinwerferkegel endet, beginnt die absolute Dunkelheit. Schwarz! So schwarz, wie es nur schwarz sein kann. Vergleichbares gibt es in Zentraleuropa nicht. Bei uns im dicht besiedelten Deutschland gibt es schon lange keine wirklich dunklen Orte mehr. Der Himmel ist bedingt durch die Lichtverschmutzung nie ganz dunkel, selbst im Wald kann man nachts am Niederrhein problemlos die Hand vor Augen erkennen. In Nordschweden nicht, so lange der Mond nicht leuchtet.
Und das führt im Ergebnis dazu, dass sich eine Fahrt im Dunkeln auf der Europastraße 45 anfühlt, als gleitet man durchs dunkle Weltall. 80km/h fühlt sich dabei verdammt schnell an ist sehr anstrengend für die Augen. Auch, weil die Angst vor einem Unfall mit Rentieren oder einem Elch mitfährt und man besonders konzentriert sein muss. Eine Kollision mit einem Elch endet in vielen Fällen für ALLE Beteiligten tödlich. Elchwarnschilder nehmen wir deshalb besonders ernst und fahren an solchen Stellen langsamer.
Bereiche, die mit schwarzen Plastiktüchern oder Säcken am Straßenrand markiert sind, verlangen ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Diese Markierungen werden von den Sami, den Ureinwohnern Lapplands, dort angebracht. Sie weisen darauf hin, dass ihre Rentiere an solchen Stellen öfter die Straße überqueren.
Rentiere gehören in Lappland nämlich nicht einfach zur Natur dazu, sie sind seit Urzeiten Eigentum der Sami, die schon hier oben gelebt und Rentiere gezähmt haben, als in Europa Geschichte noch nicht aufgeschrieben wurde und die Antike noch in ferner Zukunft lag.
Zu dieser Zeit haben die Sami bereits in Lappland gelebt. Woher sie kamen, ist bis heute noch nicht abschließend geklärt, aber sie fingen sehr früh damit an, Rentiere zu zähmen und sie als Zugtiere vor ihren Schlitten zu nutzen.
Das erklärt, warum Rentiere sehr zahm sind. Wilde Rene gibt es fast keine in Lappland und die Sami haben als einzige in Schweden und Norwegen das Privileg zur Rentierhaltung. Die Herden leben das ganze Jahr über frei. Sie werden von den Sami halbnomadisch begleitet und betreut.
Die Zahmheit der Rentiere haben wir am Abend unserer ersten langen Etappe durch Schweden schließlich selbst erfahren. Plötzlich war da vor uns keine Straße mehr, sondern Rentiere. Eine ganze Herde stand vor uns auf der Straße. Wir schätzen, es waren mindestens 30 Tiere. Ich habe sie früh genug gesehen, um gut bremsen zu können. Das war auch wichtig, weil alle Rentiere auf der Straße geblieben sind. Nicht einmal die Hupe hat sie vertrieben. Wir mussten anhalten und uns ganz langsam, langsamer als Schritttempo, zwischen den niedlichen Hornträgern hindurchwurschteln. Einerseits waren wir natürlich erschrocken, andererseits hochgradig glücklich, so eine Begegnung erlebt zu haben. Wir sind so nah und sachte an Ihnen vorbei geschlichen, dass der Subaru sie fast mit den Außenspiegeln berührt hätte.
Ein Fotos hat Sabrina zum Schluss noch machen können. Aber es ist wie bei der Sichtung von UFOs. Unscharf, dunkel und den besten Moment verpasst.

Rentiere auf der E 45
Nach dieser Begegnung war klar, wir brauchten dringend einen Platz zum übernachten. Bis zum nächsten Campingplatz war es noch eine gute Stunde, aber die verlief ruhig und ohne weitere Begegnungen.
Der Stellplatz, den wir gefunden hatten, war für uns ein absoluter Segen. Es war bereits 23 Uhr und der Besitzer des Platzes war noch wach, aber gerade auf dem Weg ins Bett. Wir durften uns hinstellen wo wir wollten, Strom nehmen soviel wir brauchten und heiße Duschen gab es auch. Nur eine Bedingung hat er gestellt: Wir sollten ihn nur bitte nicht am nächsten Morgen zum Bezahlen wecken und die Übernachtungs als Geschenk betrachten.
Herzlich Willkommen in Svealand!
Der Subaru war 10 Minuten später zum Schlafwagen umgebaut und kurze Zeit später waren Sabrina, Filou und ich im Reich der Träume.
Wie wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, was wir in Kiruna erlebt haben und wie sich der Subaru auf Schnee und Eis geschlagen hat, erfahrt ihr im nächsten Teil.
 Lieber Peter, schön mal wieder mit Ihnen gesprochen zu haben. Vielen Dank für die Tipps zur Windfahne!
Lieber Peter, schön mal wieder mit Ihnen gesprochen zu haben. Vielen Dank für die Tipps zur Windfahne! Hier die Beweise. Von den Wasserhosen gab es vier auf dem Weg nach Gibraltar. Eine hat mich schlussendlich getroffen. Das hat mich sehr verblüfft. Das Meer ist ja gross, die Wahrscheinlichkeit, mich nicht zu treffen ja ebenso. Es ging rasend schnell. Die arme Wendy sah danach etwas traurig aus. Es hat die Anlage einmal aus dem Lager gehoben. Zuerst dachte ich jetzt ist wirklich etwas kaputt. Aber dem scheint nicht so zu sein. Nur die Windfahne hat es zerlegt. Zum Glück! Wüsste ja gar nicht, was ich ohne die gute Wendy tun sollte!
Hier die Beweise. Von den Wasserhosen gab es vier auf dem Weg nach Gibraltar. Eine hat mich schlussendlich getroffen. Das hat mich sehr verblüfft. Das Meer ist ja gross, die Wahrscheinlichkeit, mich nicht zu treffen ja ebenso. Es ging rasend schnell. Die arme Wendy sah danach etwas traurig aus. Es hat die Anlage einmal aus dem Lager gehoben. Zuerst dachte ich jetzt ist wirklich etwas kaputt. Aber dem scheint nicht so zu sein. Nur die Windfahne hat es zerlegt. Zum Glück! Wüsste ja gar nicht, was ich ohne die gute Wendy tun sollte! Die Anfahrt im Sonnenaufgang auf Gibraltar war magisch. Ich bin jetzt im Mittelmer und segle erst mal weiter. Weiss auch gar nicht, warum ich zurück nach Deutschland sollte. Das ist schön hier! Kleine Mittelmeerrunde mit Balearen und dann wieder raus auf den Atlantik. Die Routenplanung mit Kanaren, Madeira oder doch Azoren schau ich mir noch mal an!
Die Anfahrt im Sonnenaufgang auf Gibraltar war magisch. Ich bin jetzt im Mittelmer und segle erst mal weiter. Weiss auch gar nicht, warum ich zurück nach Deutschland sollte. Das ist schön hier! Kleine Mittelmeerrunde mit Balearen und dann wieder raus auf den Atlantik. Die Routenplanung mit Kanaren, Madeira oder doch Azoren schau ich mir noch mal an! Ich mach mich morgen auf die Suche nach Sperrholz. Hab hier jetzt Sheppards an der Marina Bay und Gib Yachts südlich der Queesway Quay Marina herausgesucht. Wenn Sie noch Tipps haben, immer gerne!
Ich mach mich morgen auf die Suche nach Sperrholz. Hab hier jetzt Sheppards an der Marina Bay und Gib Yachts südlich der Queesway Quay Marina herausgesucht. Wenn Sie noch Tipps haben, immer gerne! PS: Das Sperrholzproblem wurde unkonventionell gelöst: Fraukes Schwester wohnt in Hamburg um die Ecke … hat zwei Windfahnen aus unserem Regeal erlöst … und sodann ihre Schwester in Spananien besucht, zur Beweissicherung dieses Foto gemacht.
PS: Das Sperrholzproblem wurde unkonventionell gelöst: Fraukes Schwester wohnt in Hamburg um die Ecke … hat zwei Windfahnen aus unserem Regeal erlöst … und sodann ihre Schwester in Spananien besucht, zur Beweissicherung dieses Foto gemacht.
 Sehr geehrter Herr Fahnemann, Wie geht es Ihnen? Wir sind stolze Eigner von einem Windpilot, eingebaut in unsrem Alubat OVNI 445, Baujahr 2011. Anfangs unsrer Weltumseglung haben wir mit Ihnen von Kanarien einmal gesprochen und auf unsren Passaten die Steuereinlage verwendet.
Sehr geehrter Herr Fahnemann, Wie geht es Ihnen? Wir sind stolze Eigner von einem Windpilot, eingebaut in unsrem Alubat OVNI 445, Baujahr 2011. Anfangs unsrer Weltumseglung haben wir mit Ihnen von Kanarien einmal gesprochen und auf unsren Passaten die Steuereinlage verwendet.
 Dear Peter, It has been more than 3 years since we installed your excellent Windpilot and we have travelled from the UK, across the Atlantic, all over the Caribbean and now up the West coast of the USA. The Windpilot has steered most of the way and has performed outstandingly.
Dear Peter, It has been more than 3 years since we installed your excellent Windpilot and we have travelled from the UK, across the Atlantic, all over the Caribbean and now up the West coast of the USA. The Windpilot has steered most of the way and has performed outstandingly. This year, with the large amount off Sargasso Weed in the Atlantic, we have had problems stopping the servo rudder from kicking up when weed collects on it.
This year, with the large amount off Sargasso Weed in the Atlantic, we have had problems stopping the servo rudder from kicking up when weed collects on it.  2. An idea to stop weed from collecting in the first place could be by making the leading edge of the rudder blade look like a very blunt hacksaw blade (with the teeth pointing down). When a piece of weed collects the serrations would stop the weed from sliding up the blade and as the boat rises and falls the weed would be forced further down with each rise and dip. It would eventually be washed away from the bottom of the blade. I have watched the weed gather and it is only when several pieces start to accumulate that it becomes too heavy for the nylon “fuse” screw.
2. An idea to stop weed from collecting in the first place could be by making the leading edge of the rudder blade look like a very blunt hacksaw blade (with the teeth pointing down). When a piece of weed collects the serrations would stop the weed from sliding up the blade and as the boat rises and falls the weed would be forced further down with each rise and dip. It would eventually be washed away from the bottom of the blade. I have watched the weed gather and it is only when several pieces start to accumulate that it becomes too heavy for the nylon “fuse” screw.

 Basicly the plastic screw is has been considered not as kind of „fuse“ but more a small hint about the perfect positioning of the rudder relevant to its holding shaft…. as other wise you may have a need of about 100 spare srews… If you have been trained for the perfect alignment … just no further need of new screws…
Basicly the plastic screw is has been considered not as kind of „fuse“ but more a small hint about the perfect positioning of the rudder relevant to its holding shaft…. as other wise you may have a need of about 100 spare srews… If you have been trained for the perfect alignment … just no further need of new screws… My advice: please do not turn / lock the bolt 435 too hard … enabling the rudder oar to tilt to the aft … avoiding any risk of getting snapped …
My advice: please do not turn / lock the bolt 435 too hard … enabling the rudder oar to tilt to the aft … avoiding any risk of getting snapped …
 Gerd Wübben und seine Frau sind auf Südkurs unterwegs, der Liegeplatz wurde bezahlt, die Werft wird den Seglern das Liegegeld erstatten, wenn ein neuer Eigner die Pflichten übernimmt. Einzelheiten bitte direkt mit dem Eigner absprechen, der sich bereits auf See befindet, gleichwohl aber erreichbar ist, zumindest, wdenn er in einem Hafen ist:
Gerd Wübben und seine Frau sind auf Südkurs unterwegs, der Liegeplatz wurde bezahlt, die Werft wird den Seglern das Liegegeld erstatten, wenn ein neuer Eigner die Pflichten übernimmt. Einzelheiten bitte direkt mit dem Eigner absprechen, der sich bereits auf See befindet, gleichwohl aber erreichbar ist, zumindest, wdenn er in einem Hafen ist: