Die Mutter aller Yachten

Ein Mix aus Waterworld und Todesstern: Der Mega-Kat Galileo © beiderbeck designs GmbH

Ein Mix aus Waterworld und Todesstern: Der Mega-Kat Galileo © beiderbeck designs GmbH

Soll im kommenden Frühjahr lieferbar sein: die 9,90 m lange offene Voltaire 33 Sky © Voltaire Electric Yachts
Fr.,03.Jul.20, Franz.Polyn./Gambier/Insel Mangareva, Tag 2224, 20.254 sm von HH
Heiva nennt sich das jährlich stattfindende Festival was im Juli auf allen Inseln in unterschiedlicher Form stattfindet. Auf Grund von Corona fällt dieses Jahr auf Tahiti die größte und kommerziellste Heiva. Gambier, weit weg von Tahiti und Corona frei, will sich dem nicht anschließen und komplett auf eine Feierlichkeit verzichten (Hao übrigens auch nicht, wie wir erfahren haben). Allerdings gibt es wenig Musik und Tanz, sondern das Programm der Heiva klingt eher wie Bundesjungendspiele: Volleyball, Kanu fahren und ein Tischtennis-Turnier stehen an. Und die Kleinsten werden mit Sackhüpfen und Tauziehen beglückt. Nur der Eröffnungstag wartet mit etwas Tanz und traditionellen Spielen auf.
Uns gefällt, dass wir nach der langen Zeit auf der Insel die Hälfte der Teilnehmer bereits kennen. Mit Thomas ist Achim schon auf Bäume geklettert, Nicolas besorgt uns Bananen und eine der Tänzerinnen ist uns doch bereits letztes Jahr aufgefallen. Irgendwie gehören wir dazu, so kommt es uns vor, na, zumindest nicht ganz fremd. ![]()
Wie die Bast-Röcke entstehen haben wir beim Wandern im Wald gesehen: Von jungen Schößlingen wird noch vor Ort die Rinde abgezogen und dann auf einer Leine zum Trocknen gehängt
Zwischen Tanz und Bananen-Wettrennen gibt es ein Fingerfood-Buffet. Ganz kann man sich nicht dem Eindruck verwehren, dass die meisten Zuschauer nur deswegen gekommen sind. Wie Kokosnüsse geschlachtet werden, kennen sie. Aber kleine Köstlichkeiten scheint es seltener zu geben. Und es gibt reichlich zu essen! Platten über Platten werden über einen Tresen gereicht. Süße Küchelchen und Zucker-Pasteten liegen neben Mini-Würstchen im Schlafrock, Sushi-Rollen und Speck-Törtchen.
Die Geschwindigkeit in der die Mengen verschlungen werden, ist beeindruckend. Ich sehe Jungs, die sich von zwei Platten gleichzeitig bedienen. Ungeniert werden sich auf mitgebrachte Pappteller die Teilchen gehäuft. Zehn Stück und mehr, kein Problem, es wir so lange zugelangt bis ein Berg auf dem Teller entstanden ist. Die Mädchen, die mit den Platten umhergehen, sind unbeeindruckt: ‚wenn der junge Mann Hunger hat, soll er nur reinhauen‘, verraten ihre Mienen.
Fingerfood in rauen Mengen
Besonders spektakulär sind die Spiele und Vorstellungen auch für uns nicht, aber da ansonsten jeder Abend an Bord dem anderen gleicht und wir wenig Abwechslung geboten bekommen, fühlen wir uns gut unterhalten. ![]()
Auf einer in den Boden gerammten Spitzhacke wird der Bast von den Nüssen gepuhlt
Mit Hilfe einer Raspel wird das Kokosfleisch aus den Hälften geschabt – man achte auf die Dame rechts ![]() mit den Socken in den FlipFlops
mit den Socken in den FlipFlops
Durch ein Tuch wird die Kokosmilch aus dem Fleisch gepresst.
Wer noch immer denkt, ich mache Witze über die Kälte hier. Südsee … hahahaha!
WIE VIELE LEBEN HAT EIN SCHIFF?
 Schiffsnamen können eine Menge verraten, zwangsläufig ist das allerdings nicht, aber ein Zufallstreffer wird schon interessant. Wikipedia hilft feinsinnig, aber auch dort wird dem Leser nur ein Anstoss gegeben.
Schiffsnamen können eine Menge verraten, zwangsläufig ist das allerdings nicht, aber ein Zufallstreffer wird schon interessant. Wikipedia hilft feinsinnig, aber auch dort wird dem Leser nur ein Anstoss gegeben.

Der Schüler fragte den Meister, was den Meister von ihm unterscheide. Der Zen-Meister entgegnete ihm: „Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Der Schüler erwiderte: „Aber das mache ich doch auch.“ Der Zen-Meister antwortete:“Wenn Du gehst, denkst Du ans Essen und wenn Du isst, dann denkst Du ans Schlafen. Wenn Du schlafen sollst, denkst Du an alles Mögliche. Das unterscheidet uns.“
 Die Geschichte von Nikki und Mike Reynolds, einem Seglerpaar aus Freemantle in Western Australia entwickelte sich ungewöhnlich und aussergewöhnlich umfangreich, was hier nun keine Beschwerde ist, hingegen Ausdruck ungewöhnlichen Fachwissens meines Gegenübers. Fachwissen, das im Verlauf von 40 Mailwechseln im Verlauf von 18 Monaten aus allen Ritzen gekrochen kam.
Die Geschichte von Nikki und Mike Reynolds, einem Seglerpaar aus Freemantle in Western Australia entwickelte sich ungewöhnlich und aussergewöhnlich umfangreich, was hier nun keine Beschwerde ist, hingegen Ausdruck ungewöhnlichen Fachwissens meines Gegenübers. Fachwissen, das im Verlauf von 40 Mailwechseln im Verlauf von 18 Monaten aus allen Ritzen gekrochen kam.
Die Fotos der Zen Again offenbarten ein blitzblank gepflegtes Schiff eines Liveaboard Paares, dass aus seiner Heimat nach England gesegelt war, dort seit einiger Zeit in Gosport seinen Liegeplatz innehat und auf der Insel sein Geld verdient. Mike arbeitet als Consultant Engineer im Bereich electronic integrated circuit design. Das Schiff, ein ¾ Tonner Ken Hayashi ST10.4 aus 1986 von Yamazaki Yachts war mir bislang tatsächlich unbekannt, was in meinem Leben selten passiert, denn selbst die meisten japanische Schiffe sind mir recht gut vertraut. Mike´s Vermerk, dass nur sechs Schiffe gebaut worden sind … war die Erklärung, die mir geholfen hat, meine Wissenslücke zu verdauen.
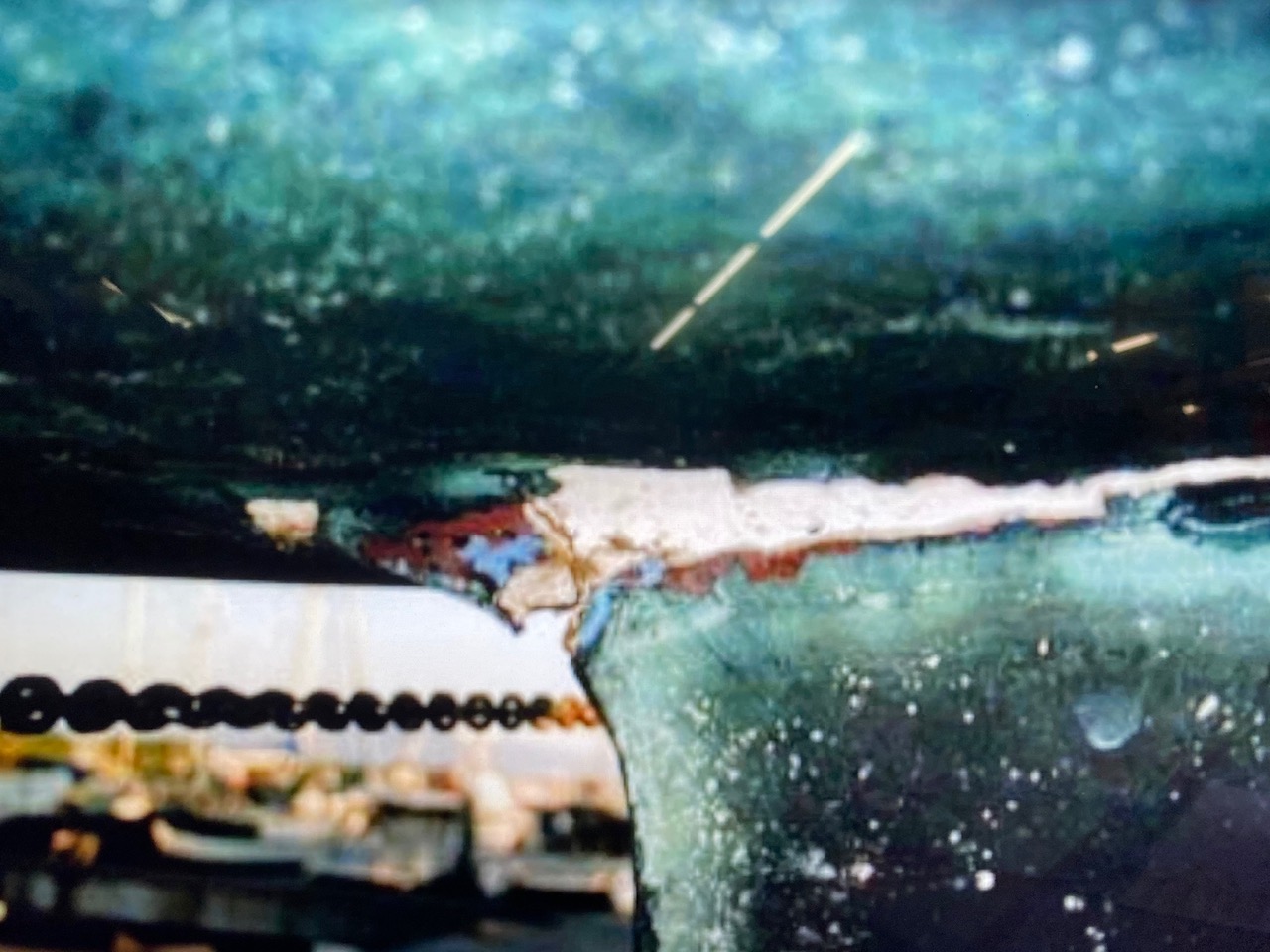 Ein Schiff von 34 Jahren dessen ursprünglich Name Zen gewesen ist. Die Demarkationslinie eine Historie, die Weltreisen unter dem Ersteigner aufweist, eine harte Strandung, bei der der Kiel sich vom Rumpf gelöst und einer spektakuläre Beschlagnahme infolge Drogenschmuggels im Werte von ca 120 Mio AUS $ durch die Australische Marine vor der Ostküste, wobei die japanischen Eigner verurteil wurden. Das Schiff kam zur Versteigerung. Nikki und Mike wurden die neuen Eigner. Nach dem Refit wurde auch der Name in Zen Again verändert, eine Logik, deren Sinn sich von selbst ergibt.
Ein Schiff von 34 Jahren dessen ursprünglich Name Zen gewesen ist. Die Demarkationslinie eine Historie, die Weltreisen unter dem Ersteigner aufweist, eine harte Strandung, bei der der Kiel sich vom Rumpf gelöst und einer spektakuläre Beschlagnahme infolge Drogenschmuggels im Werte von ca 120 Mio AUS $ durch die Australische Marine vor der Ostküste, wobei die japanischen Eigner verurteil wurden. Das Schiff kam zur Versteigerung. Nikki und Mike wurden die neuen Eigner. Nach dem Refit wurde auch der Name in Zen Again verändert, eine Logik, deren Sinn sich von selbst ergibt.
 Segler von Kindesbeinen, Selbstbauer eines 38ft One Off in Woodcore, mit dem sie das Sydney Hobart Race gesegelt sind, zuhause in Freemantle Western Australia mit enger Bindung zur dortigen Seglerschaft. Und Erfahrungen mit nahezu sämtlichen Windsteueranlagen von Aries über Monitor nun einer Windpilot Pacific, die seit ein paar Wochen das Heck verziert.
Segler von Kindesbeinen, Selbstbauer eines 38ft One Off in Woodcore, mit dem sie das Sydney Hobart Race gesegelt sind, zuhause in Freemantle Western Australia mit enger Bindung zur dortigen Seglerschaft. Und Erfahrungen mit nahezu sämtlichen Windsteueranlagen von Aries über Monitor nun einer Windpilot Pacific, die seit ein paar Wochen das Heck verziert.
Fachdiskussionen über mein Herzthema sind stets ein Genuss, vor allem, wenn sie im Ton entspannt, gegenseitiger Respekt gewahrt und das menschliche am Ende auf ganzer Linie siegt.
Vielen Dank Nikki und Mike … ich wünsche Euch eine glückliche Heimreise
Peter Foerthmann WEITERLESEN

JEANNEAU 26 – OSTSEE SOMMER ESTLAND UND ZURÜCK
 Lieber Peter Förthmann, eines vornweg : Ich bin immer wieder begeistert von der Windpilot. Vor 2 Jahren hatte die mich über 2000 sm rund Ostsee unter allen Bedingungen gesteuert. Mitte Mai bin ich dann von meinem Heimatrevier aus die Flüsse Spree und Oder lang runter in Richtung Stettiner Haff gestartet.
Lieber Peter Förthmann, eines vornweg : Ich bin immer wieder begeistert von der Windpilot. Vor 2 Jahren hatte die mich über 2000 sm rund Ostsee unter allen Bedingungen gesteuert. Mitte Mai bin ich dann von meinem Heimatrevier aus die Flüsse Spree und Oder lang runter in Richtung Stettiner Haff gestartet.
 Überwiegend habe ich als Crew immer einen Mitsegler auf der Tour dabei, idR Freunde aus allen Zeiten, die sich sofort für ein Stück Mitsegeln interessierten. Bisher war ein richtiger Segler mit Erfahrung dabei, der selbst Eigner einer neuen 35 Fuß Degerö ist. In kurzen Worten, die Windpilot funktionierte auf Anhieb sehr gut und ich werde meinen Freunden im Segelclub die selbst größere Touren machen, anhand der Plotter Aufzeichnungen zeigen können, wie gut die Windpilot steuert. Inzwischen habe ich Sie auf allen möglichen Kursen genutzt auch bei achterlichem Wind auf dem kleinen Boot, sicheres steuern – das macht Spaß.
Überwiegend habe ich als Crew immer einen Mitsegler auf der Tour dabei, idR Freunde aus allen Zeiten, die sich sofort für ein Stück Mitsegeln interessierten. Bisher war ein richtiger Segler mit Erfahrung dabei, der selbst Eigner einer neuen 35 Fuß Degerö ist. In kurzen Worten, die Windpilot funktionierte auf Anhieb sehr gut und ich werde meinen Freunden im Segelclub die selbst größere Touren machen, anhand der Plotter Aufzeichnungen zeigen können, wie gut die Windpilot steuert. Inzwischen habe ich Sie auf allen möglichen Kursen genutzt auch bei achterlichem Wind auf dem kleinen Boot, sicheres steuern – das macht Spaß.
 Eine Bewährungsprobe war bei Starkwind auf Kaliningrad zu, da mussten wir (ich) unterwegs noch einmal Kontakt zu Boarderguard und anderem Traffic Control aufnehmen – ich war defacto Single handed unterwegs – 1,5m Welle – Boot hat sicher Kurs gehalten.
Eine Bewährungsprobe war bei Starkwind auf Kaliningrad zu, da mussten wir (ich) unterwegs noch einmal Kontakt zu Boarderguard und anderem Traffic Control aufnehmen – ich war defacto Single handed unterwegs – 1,5m Welle – Boot hat sicher Kurs gehalten.
Also alles bestens.
Eine Frage habe ich trotzdem: Ist es richtig, dass der Pendelarm (nr.300) mit Lagerschale (nr.302) von Anfang an (für meine Begriffe etwas zu viel) Spiel hat? Weil einstellen kann man ja da nicht wirklich etwas. Wäre schön, kurz dazu von Ihnen zu hören
Mit seglerischen Grüßen von der Ostsee zZ Saaremaa (Estland)
Eckehard Schulz, SY KatiKati
Mein Kommentar
Moin Herr Schulz, danke für die netten Zeilen … endlich mal ein Windpilot, der funktioniert … :))
LAGERSPIEL: ist elementar und notwendigerweise vorhanden. Ist es zu klein, setzen sich die Lager voll Salz … und dann geht erst die Leichtgängigkeit flöten… danach die ganze Anlage zum Schlafen.
Mein Rat: weiter segeln, keine Sorgen machen …..
schicke Grüße und Good Luck für einen weiteren tollen Segelsommer!
Peter Foerthmann

Sebastian Kummer und Jens Brambusch beim ersten Treffen in Göcek © Jens Brambusch
Es ist beeindruckend und erschreckend, den Zusammenbruch einer ganzen Branche hautnah zu erleben.
Samstag Nachmittag, München Airport, Terminal 2, auf dem Weg nach Mallorca: Eine Halle voller LUFTHANSA-Abfertigungsschalter. Aber von den 30, 40 Schaltern, an denen vor einem Jahr eingecheckt, abgefertigt, Gepäck aufgegeben wurden, ist nur einer geöffnet. Keine Fluggäste. Kein Personal. Jetzt, Anfang Juli? An einem Samstag Nachmittag um 14 Uhr? Vor einem Jahr hätte hier schon morgens um acht Gedränge geherrscht um diese Zeit. Jetzt heben von Mittag bis Mitternacht gerade mal zwei Dutzend Flieger ab. Alle vom Terminal 2, für Terminal 1 zeigt die Anzeige im Zentralbereich nichts an. Terminal 1 scheint stillgelegt.
„Seit 14 Tagen geht es wieder aufwärts“, meint der Apotheker im Terminal 2, in dessen Laden ich plötzlich stehe. Er ist nicht verzweifelt. Er meint, was er sagt. Auch wenn die Apotheke einer der wenigen Läden im Terminal ist, die geöffnet haben. Wie bitte? Eine einsame Kundin vor mir kauft ein 10er Pack Masken. Die übrigen Geschäfte sind dunkel, mit Absperrbändern abgeklebt. Stillstand. „Seit 14 Tagen spüren wir, es geht aufwärts“, beharrt der Apotheker auf meine Frage, wie er das letzte Vierteljahr wirtschaftlich durchgestanden habe. So recht mag er nicht drüber reden. Aber ein Geheimnis ist es auch nicht. Was kann ein Ladeninhaber schon tun, der seinen Shop an einer der belebtesten Straßen einer Großstadt eröffnete, wenn er plötzlich feststellt: Nicht nur die Straße, sondern die ganze Großstadt ist weg. Er hat ja nur drei Möglichkeiten: Mit dem Vermieter über die Miete reden. Seinen Warenbestand klein halten, nur noch das Notwendigste einkaufen. Möglichst viel selber im Laden stehen, weil er sich kein Personal mehr leisten kann.
Und da erscheinen dann plötzlich die Folgen der Krise der letzten Monate vor meinem inneren Auge. Wie eine lange Kette der fallenden Dominosteine, die an einem Ort wie diesen ihren Anfang nimmt, ausgelöst von einem – oder mehreren – strauchelnden Luftfahrtriesen, scheinbar weit entfernt von meinem Leben. Wie die Reihe der fallenden Dominosteine einen nach dem anderen der nachfolgenden Stein umwirft und Steinchen um Steinchen fällt, bis die Kette irgendwann in meinem Dorf angekommen ist und quer durch mein Wohnzimmer läuft.
Mit dem Vermieter über die Miete reden? Wie reagiert eine Flughafenbetreibergesellschaft, wenn plötzlich nicht nur mehr ADIDAS nicht zahlt, sondern keiner der Mieter? Wenn die Umsätze wegbrechen? Und wie eine Stadt, wenn sie weniger Einnahmen hat, weil der Flughafenbetreiber keine Gewerbesteuern mehr bezahlt?
Den Warenbestand klein halten? Vernünftig. Wie reagieren Hersteller und Lieferanten, wenn Shops wie diese Apotheke von einem Tag auf den anderen nur noch OP-Masken einkaufen? Sie werden nur noch das notwendigste einkaufen und Personal abbauen.
Selber im Laden stehen? Gute Idee. Aber was tun die 7 Mitarbeiterinnen, die bisher die Apotheke rund um die Uhr am Laufen hielten? Und die 30 Köche und Servicekräfte aus der Gastronomie gegenüber? Auch weniger einkaufen.
„Die Lufthansa-Leute gehen davon aus, es wird 3-4 Jahre dauern, bis hier am Airport wieder die Kundenzahlen von 2019 erreicht werden.“ Der Apotheker ist nicht verzweifelt, als er das sagt. Er strahlt die Gewissheit aus, dass er sein Geschäft durchbringen wird. Obs die Sommerferien richten, die in Bayern in drei Wochen beginnen? „Das wird maximal 20%, 23% eines üblichen August erreichen“, erwartet der Apotheker. Auch ich bin nicht panisch. Mir ist nur an diesem Samstag Nachmittag klar, dass sich unsere Welt verändern wird. Und ganz sicher in vier Jahren nicht mehr dieselbe sein wird, in der wir 2019 lebten.
Alles ist offen – jedenfalls was die Zukunft angeht, und weniger die Grenzen. Später, beim Einchecken, herrscht Chaos. Nach Palma de Mallorca fliegen an diesem Samstag Nachmittag zwei Maschinen. Sie sind gut besetzt. Die meisten Passagiere haben mitbekommen, dass die spanische Regierung bei der Einreise eine Art Gesundheits-Erklärung jedes Reisenden fordert, um mögliche Infektionsketten sofort verfolgen zu können.. Es gibt eine „Spain Travel Health“, die SPTH-App, die einen Barcode erzeugt. Die meisten der Passagiere an diesem Nachmittag haben den Barcode, fallen dann aber doch aus allen Wolken, als die EUROWINGS-Mitarbeiter kopierte Zettel verteilen, die ausgefüllt werden müssen. Zusätzlich. Nein Barcode reicht nicht. Jeder muss einen Zettel haben und in Palma dort abgeben, wo bei der Einreise die Körpertemperatur gemessen wird.
Alles etwas chaotisch. Aber nach sieben Stunden ununterbrochen Maske tragen nehme ich dann doch vor dem Flughafengebäude von Palma zum ersten Mal die Maske ab. Ich hätte das doch vorher trainieren sollen zuhause, 7, 8 Stunden daheim. Wir hätten trainieren sollen, was der Purser beim Aussteigen ansagt, dass wir jetzt sitzenbleiben. Und „Reihe für Reihe aussteigen“. Und nicht alle gleichzeitig aufspringen und dichtgedrängt im Flugzeug warten aufs Öffnen der Türen, als wäre dies noch die Welt, wie sie 2019 war.
Aber dann stehe ich plötzlich unter dem Abendhimmel über Mallorca. Ich sehe diese unglaublichen Wolken, die alle unbändige Kraft des Meeres in sich eingefangen haben über der Insel. Und für einen Moment scheint es mir: Als könnte alles unserer Welt nichts anhaben.
Soeben erschienen:
Worum gehts?
Mallorca. Menorca. Und die restlichen Inseln, die zwischen Sizilien und der südenglischen Isle of Wight liegen.
„Ein Pageturner.“
Sagt mein Freund Josef (Er ist nie gesegelt)
„Hab die ersten Seiten gelesen. Irre. Grandios. Megastark“.
Sagt mein Freund Andreas (Er ist mit mehrfach mir mir gesegelt. Und liest Bücher von Berufs wegen.)
„Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Es hat mir so viel Kraft in dieser schweren Zeit gegeben, und Freude! Deine Sprache fesselt nicht nur, sie lässt auch ganz direkt miterleben, als wäre man selbst mitten im Geschehen.“
Magdalena (segelte auf dem See.)
„Es ist so ehrlich, authentisch und im positiven Sinne anders als die vielen Segelbücher.“
Sagt ein Leser, der mich damit zum Erröten brachte.
Und was ich drüber denke?
Ich bin bescheidener. Und verrate es in einem der nächsten Posts.
Es ist beeindruckend und erschreckend, den Zusammenbruch einer ganzen Branche hautnah zu erleben.
Samstag Nachmittag, München Airport, Terminal 2, auf dem Weg nach Mallorca: Eine Halle voller LUFTHANSA-Abfertigungsschalter. Aber von den 30, 40 Schaltern, an denen vor einem Jahr eingecheckt, abgefertigt, Gepäck aufgegeben wurden, ist nur einer geöffnet. Keine Fluggäste. Kein Personal. Jetzt, Anfang Juli? An einem Samstag Nachmittag um 14 Uhr? Vor einem Jahr hätte hier schon morgens um acht Gedränge geherrscht um diese Zeit. Jetzt heben von Mittag bis Mitternacht gerade mal zwei Dutzend Flieger ab. Alle vom Terminal 2, für Terminal 1 zeigt die Anzeige im Zentralbereich nichts an. Terminal 1 scheint stillgelegt.
„Seit 14 Tagen geht es wieder aufwärts“, meint der Apotheker im Terminal 2, in dessen Laden ich plötzlich stehe. Er ist nicht verzweifelt. Er meint, was er sagt. Auch wenn die Apotheke einer der wenigen Läden im Terminal ist, die geöffnet haben. Wie bitte? Eine einsame Kundin vor mir kauft ein 10er Pack Masken. Die übrigen Geschäfte sind dunkel, mit Absperrbändern abgeklebt. Stillstand. „Seit 14 Tagen spüren wir, es geht aufwärts“, beharrt der Apotheker auf meine Frage, wie er das letzte Vierteljahr wirtschaftlich durchgestanden habe. So recht mag er nicht drüber reden. Aber ein Geheimnis ist es auch nicht. Was kann ein Ladeninhaber schon tun, der seinen Shop an einer der belebtesten Straßen einer Großstadt eröffnete, wenn er plötzlich feststellt: Nicht nur die Straße, sondern die ganze Großstadt ist weg. Er hat ja nur drei Möglichkeiten: Mit dem Vermieter über die Miete reden. Seinen Warenbestand klein halten, nur noch das Notwendigste einkaufen. Möglichst viel selber im Laden stehen, weil er sich kein Personal mehr leisten kann.
Und da erscheinen dann plötzlich die Folgen der Krise der letzten Monate vor meinem inneren Auge. Wie eine lange Kette der fallenden Dominosteine, die an einem Ort wie diesen ihren Anfang nimmt, ausgelöst von einem – oder mehreren – strauchelnden Luftfahrtriesen, scheinbar weit entfernt von meinem Leben. Wie die Reihe der fallenden Dominosteine einen nach dem anderen der nachfolgenden Stein umwirft und Steinchen um Steinchen fällt, bis die Kette irgendwann in meinem Dorf angekommen ist und quer durch mein Wohnzimmer läuft.
Mit dem Vermieter über die Miete reden? Wie reagiert eine Flughafenbetreibergesellschaft, wenn plötzlich nicht nur mehr ADIDAS nicht zahlt, sondern keiner der Mieter? Wenn die Umsätze wegbrechen? Und wie eine Stadt, wenn sie weniger Einnahmen hat, weil der Flughafenbetreiber keine Gewerbesteuern mehr bezahlt?
Den Warenbestand klein halten? Vernünftig. Wie reagieren Hersteller und Lieferanten, wenn Shops wie diese Apotheke von einem Tag auf den anderen nur noch OP-Masken einkaufen? Sie werden nur noch das notwendigste einkaufen und Personal abbauen.
Selber im Laden stehen? Gute Idee. Aber was tun die 7 Mitarbeiterinnen, die bisher die Apotheke rund um die Uhr am Laufen hielten? Und die 30 Köche und Servicekräfte aus der Gastronomie gegenüber? Auch weniger einkaufen.
„Die Lufthansa-Leute gehen davon aus, es wird 3-4 Jahre dauern, bis hier am Airport wieder die Kundenzahlen von 2019 erreicht werden.“ Der Apotheker ist nicht verzweifelt, als er das sagt. Er strahlt die Gewissheit aus, dass er sein Geschäft durchbringen wird. Obs die Sommerferien richten, die in Bayern in drei Wochen beginnen? „Das wird maximal 20%, 23% eines üblichen August erreichen“, erwartet der Apotheker. Auch ich bin nicht panisch. Mir ist nur an diesem Samstag Nachmittag klar, dass sich unsere Welt verändern wird. Und ganz sicher in vier Jahren nicht mehr dieselbe sein wird, in der wir 2019 lebten.
Alles ist offen – jedenfalls was die Zukunft angeht, und weniger die Grenzen. Später, beim Einchecken, herrscht Chaos. Nach Palma de Mallorca fliegen an diesem Samstag Nachmittag zwei Maschinen. Sie sind gut besetzt. Die meisten Passagiere haben mitbekommen, dass die spanische Regierung bei der Einreise eine Art Gesundheits-Erklärung jedes Reisenden fordert, um mögliche Infektionsketten sofort verfolgen zu können.. Es gibt eine „Spain Travel Health“, die SPTH-App, die einen Barcode erzeugt. Die meisten der Passagiere an diesem Nachmittag haben den Barcode, fallen dann aber doch aus allen Wolken, als die EUROWINGS-Mitarbeiter kopierte Zettel verteilen, die ausgefüllt werden müssen. Zusätzlich. Nein Barcode reicht nicht. Jeder muss einen Zettel haben und in Palma dort abgeben, wo bei der Einreise die Körpertemperatur gemessen wird.
Alles etwas chaotisch. Aber nach sieben Stunden ununterbrochen Maske tragen nehme ich dann doch vor dem Flughafengebäude von Palma zum ersten Mal die Maske ab. Ich hätte das doch vorher trainieren sollen zuhause, 7, 8 Stunden daheim. Wir hätten trainieren sollen, was der Purser beim Aussteigen ansagt, dass wir jetzt sitzenbleiben. Und „Reihe für Reihe aussteigen“. Und nicht alle gleichzeitig aufspringen und dichtgedrängt im Flugzeug warten aufs Öffnen der Türen, als wäre dies noch die Welt, wie sie 2019 war.
Aber dann stehe ich plötzlich unter dem Abendhimmel über Mallorca. Ich sehe diese unglaublichen Wolken, die alle unbändige Kraft des Meeres in sich eingefangen haben über der Insel. Und für einen Moment scheint es mir: Als könnte alles unserer Welt nichts anhaben.
Soeben erschienen:
Worum gehts?
Mallorca. Menorca. Und die restlichen Inseln, die zwischen Sizilien und der südenglischen Isle of Wight liegen.
„Ein Pageturner.“
Sagt mein Freund Josef (Er ist nie gesegelt)
„Hab die ersten Seiten gelesen. Irre. Grandios. Megastark“.
Sagt mein Freund Andreas (Er ist mit mehrfach mir mir gesegelt. Und liest Bücher von Berufs wegen.)
„Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Es hat mir so viel Kraft in dieser schweren Zeit gegeben, und Freude! Deine Sprache fesselt nicht nur, sie lässt auch ganz direkt miterleben, als wäre man selbst mitten im Geschehen.“
Magdalena (segelte auf dem See.)
„Es ist so ehrlich, authentisch und im positiven Sinne anders als die vielen Segelbücher.“
Sagt ein Leser, der mich damit zum Erröten brachte.
Und was ich drüber denke?
Ich bin bescheidener. Und verrate es in einem der nächsten Posts.
Fr.,03.Jul.20, Franz.Polyn./Gambier/Insel Mangareva, Tag 2224, 20.254 sm von HH
Die Insel lässt uns nicht los.
So einfach ist es dann nicht, nach so langer Zeit los zu kommen. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Wir haben beim alten Fritz (dem Trans-Ocean-Stützpunktleiter-Urgestein) Tschüss gesagt und uns bei Philip verabschiedet. Achim hat Kette und Unterwasserschiff sauber getaucht. Wir haben alles verstaut und weg gerödelt und dann am Morgen der Abfahrt ein letzter Blick ins Wetter.
Heijeijeijei. Das Wetterfenster ist gut – keine Frage – für unsere geplante Ankunft am Montag. Aber ab Dienstag werden 30 Knoten Wind auf Hao vorhergesagt. Nicht schlimm, oder? Dann sind wir ja längst da. Aber was, wenn wir länger brauchen oder der starke Wind zeitgleich mit uns am Montag anreist? Dann sind wir die Doofen. Der Wind käme uns im Pass genau auf die Nase. Wir vermuten, dass wir dann dort nicht hinein fahren könnten. Acht, neun, zehn oder mehr Knoten Strömung würden uns entgegen blasen. Wir haben schon mit eigenen Augen gesehen, was dieser Pass kann. Er kann physikalische Gesetze außer Kraft setzen. Es gibt Geschichten, dass der Pass, wenn er richtig böse ist, zwanzig Knoten Strömung entstehen lassen kann. Die Abfahrt riskieren oder nicht? Zwei Stunden tagt der Crew-Rat, dann fällt die Entscheidung: wir haben es nicht eilig (die Zahnärztin kommt sowieso erst im August nach Hao zurück) und es kommen bessere Gelegenheiten.
Im Chor singen wir: „Wer weiß, wofür es gut ist …“.
Der Pass in Hao kann stehende Wellen von zwei Metern und mehr erzeugen

© borisherrmannracing
AUS DEM MASCHINENRAUM REINER LEBENSFREUDE

Die Corona-Pandemie führt weltweit zu verschiedenen Einschränkungen für den Bootssport. Wie sieht es derzeit in den Häfen in Übersee aus? Per Videochat geben Wassersportler vor Ort Auskunft über die aktuelle Situation. In Europa ist fast überall mittlerweile wieder Bootstourismus und Bootssport erlaubt, in vielen Revieren sogar fast ohne Einschränkungen zur Eindämmung von