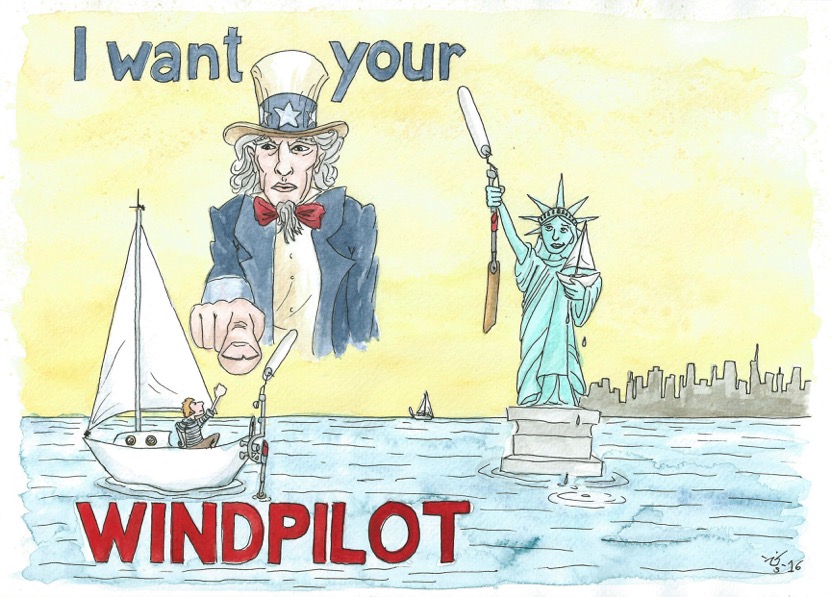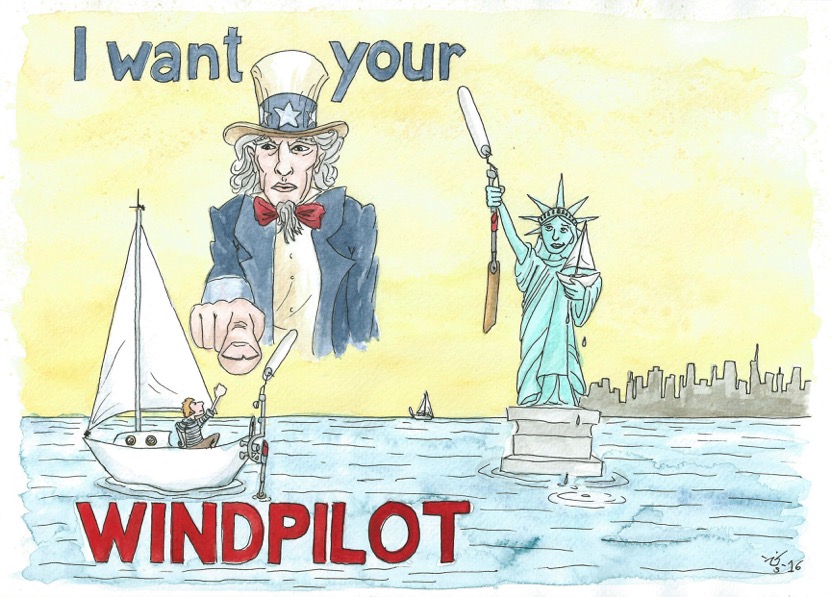Seit Mitte Mai bin ich von Sizilien aus unterwegs,
um einhand für mein neues Buchprojekt um die Westküste Europas bis in die Bretagne zu segeln.
Seit Anfang Juli bin ich in Portugal unterwegs.
Durch Zufall verschlägt es mich in die Lagunen von Aveiro.

Seit Gibraltar war es vorbei gewesen mit dem Mittelmeer-Sommer. Ein ungewöhnlicher Sommer, sagten selbst die Portugiesen. Das Wetter war grau und dunstig, meist startete ich Levjes Motor im windstillen Grau irgendeines Flusshafens, der träge von den Gezeiten durchspült wurde. Die Sonne, die am Morgen den Dunst über mir zum Leuchten brachte. In Figueira da Foz auf dem anderen Flussufer eine Feldlerche, die unsichtbar gebettet im milchigen Licht über den Marschwiesen ihr endloses Lied sang.
Ich fuhr weiter nach Norden. Es blieb grau tagsüber. Die Wellen als große Roller von Nordwesten, majestätische Hügelketten, die Levje sanft anhoben, um sie danach ebenso sanft in eine Wellental gleiten zu lassen, bis aus dem Grau die nächste Hügelkette sanft anrollte. Atlantikwelle – so ganz anders als die Wellen des Mittelmeers.
Am Nachmittag plötzlich vor mir hohe Molen im Nebel. Ein kurzer Blick in die Seekarte: Ria de Aveiro stand da. Und dahinter war ein war eine Marschlandschaft eingezeichnet, durchzogen von Adern, die alle der einen großen Arterie zustrebten, an deren Ende ich jetzt stand. Eine Lagune. Ich beschloss, einzulaufen, spontan dem größten der Flüsse zu folgen, und legte Ruder auf die Einfahrt. Kaum hatte ich die Molen passiert, setzte die Strömung ein. Der Fluss strömte mit fast drei Knoten dem Meer entgegen, wo Levje eben noch mit sechs Knoten dahinfuhr, zeigte das GPS nur nur 3 Knoten. Und Wirbel. Und Zipfelmützen. Und Strudel. Wasser, das auf breiter Front wirbelnd zur Mündung drängte, achtlos, ob da jetzt jemand drauf fuhr oder nicht. Vom einen Moment auf den anderen Levje einfach so in einem der großen Wirbel aus dem Kurs drehend, als wäre sie ein Spielzeug auf einer Drehscheibe. Ob ich dort vorne in der Einfahrt vor dem Sandstrand ankern sollte? Ein Fischer gab die Antwort. Er überholte uns rechts außen, was sollen Ebbe und Flut, er gab einfach Gas und stampfte langsam gegen die Strömung an.
Wir kamen mit 2-3 Knoten zwischen den hohen Steinmolen voran. Es machte nichts. Ein paar Angler warfen aus ihren kippeligen Booten ihre Ruten aus. Auf dem Sandstrand, der Praia da Barra, Sommerfreuden von Strandurlaubern im lichtlosen Grau. Ein hoher Leuchtturm. Nach einer halben Meile hatten wir den gröbsten Sog der Mündung hinter uns. Der Fluss lag hinter uns. Ein Frachter der uns folgte.
Lagunen. Immer wieder zogen sie mich an. Von Gezeiten, Flüssen und Kanälen durchzogenes Marschland am Meer. Ich kenne die Lagunen im Mittelmeer, ich habe viel Zeit in den Lagunen der Nordadria verbracht, als ein langes Wochenende alles war, was ich an Zeit hatte. Erst die Lagunen von Grado. Dann die von Marano und Lignano. Und dann so oft es ging, in die Lagunen von Venedig, selbst im Winter auf dem Boot. Lagunen gibt es auch in Griechenland, im Golf von Patras in Mesolonghi, wo sie den Rogen der Meeräschen ernten, einsalzen und zu Brotlaiben geformt als Delikatessen verkaufen. Und hier in Portugal ganz im Süden die Lagunen von Faro. Jetzt also die Lagunen von Aveiro.
Lagunen. Sie erzählen die Geschichte eines ungeahnt reichen Lebensraums. Und die von Salz und Fisch. Und manchmal gerät eine Fahrt durch die Lagunen zu einer Reise durch die Geschichte, sie sind wie ein offenes Buch, das berichtet, wie sie einst besiedelt wurden.

Wir haben noch immer zwei Knoten Strom gegen uns. Doch der Fluss ist nun ruhiger geworden, Strudel und Wirbel, wo der Fluss aufs Meer trifft, sind nun ein gleichmässigen Strömen gewichen. Levjes Motor wird nun von Süßwasser durchspült, denke ich, während wir am Ufer langsam an den Schlickbänken entlanggleiten, vor denen Sammler von Steckmuscheln ihre einfachen Boote vertäut haben.
Lagunen. Wahrscheinlich beginnt ihre Geschichte genau damit: Mit Jagen und Sammeln. Mit den Fischern in ihren kippeligen Booten. Und den Sammlern. Mit denen, die früh entdeckten, dass die Lagunen Nahrung in Hülle und Fülle boten, die die Gezeiten jeden Tag freilegen. Im Brackwasser gedeihen alle Arten von Fischen und Krebsen. Aber vor allem die freiliegenden Schlickbänke ziehen immer wieder die Muschel-Liebhaber an. Während Levje gegen zwei Knoten Strom flussaufwärts anmotort, passieren wir sie wieder und wieder, wie sie barfuss im Schlamm des Flusses waten und tiefgebückt nach Muscheln stochern. Soweit man es weiß, fing damit alles an in den Lagunen: Mit dem „Ernten“ dessen, was sie hergaben. Vorausgesetzt, man war bereit, ein Leben zu leben, das dem eines Wasservogels ähnlicher war: Sommer wie Winter auf dem Wasser, Umgeben vom Geruch nach Werden und Vergehen.
Eine Flussbiegung. Dahinter mündet einer zweiter Fluss. Auf der freiliegenden Schlickbank ist eine ganze Familie, die dort ihr Boot vertäut hat und jetzt im Flusschlamm nach Muscheln stochern. Hinter ihnen sehe ich weitläufige flache Gevierte, in denen Wasser steht. Salinen. Ob man die immer noch zur Salzgewinnung nutzt, denke ich, während ich im trägen Strom Ruder lege.
Auch dies gehört zur Geschichte der Lagunen: Nach dem Sammeln kam die Salzproduktion. Weiter hinten, wo vor der Stadt Alveiro die Industriebetriebe längst den Marschwiesen gewichen sind, liegen die einfachen Gevierte in den sumpfigen Marschwiesen, in die man mit der Flut das Meerwasser einströmen lässt. Dann abriegelt. Und es dann einfach über Wochen verdunsten lässt. Das „Fleur du Sel“ ensteht so, der feine auskristallisierte Salzschaum, der so kostbar ist. Und das grobkörnige Salz auch. Salz war der Grundstoff, um Fisch zu konservieren. Am Anfang wahrscheinlich nur den für den eigenen Bedarf, den die Lagunen hergaben.
Salz: Es war das Konservierungsmittel der Antike bis weit in die Neuzeit. Salzfleisch. Salzhering, Ancovis in Salz, Kapern in Salz: Ohne Salz wäre die Menschheit nie so weit gekommen, wie sie kam. Salz wurde erst abgelöst als Konservierungsmittel durch eine Erfindung, die vermutlich mehr Menschenleben rettete als die ganze Pharma-Industrie zusammen: Durch die Entdeckung der Kühlung von Lebensmitteln durch Eis. Und die nachfolgende Erfindung des Eisschranks. Aber das ist noch nicht so lange her.

Eben zieht wieder der Nebel über den Fluss. Wir haben immer noch zwei Knoten Strom gegen uns, doch ein leichter Wind weht vom Meer her über die Marschen. wir kommen damit gut voran. Ein Silberreiher steht auf einem Bein im Wasser und beobachtet uns reglos.
Irgendwann stellten die Fischer fest, dass sie mehr Salz und mehr Fisch produzierte, als sie selber verbrauchten. Sie begannen, mit dem Salzfisch zu handeln, wo er doch nun haltbar war und gleich in zwei Tagen gegessen werden musste. Weil es vor allem in den umliegenden Städten, im Binnenland, in Coimbra, in Porto dankbare Abnehmer gab, bauten sie dieses Geschäft aus. Und fischten nicht mehr nur in den Lagunen, sondern auch draußen auf dem Meer. Die Produktion von Salzfisch wurde umfangreicher. Und der Handel dehnte sich weiter aus.
Im Nebel tauchen am rechten Ufer Schemen auf: Ich steuere Levje näher heran. Drei Trawler liegen vor den Fischfabriken vertäut, als wäre dies der Ort, an dem ihre Fahrt endete. Sie waren sicher mal stolze Trawler, die auf weite Fahrt gingen und portugiesische Namen und Orte an weit entfernte Orte trugen: São Rafael, der Name des Erzengels, den so viele portugiesische Schiffe trage, weil er der portugiesische Heilige der Seefahrenden ist. Praia da Eriçeira, benannt nach dem vor Lissabon – und nach dem Hafen, der einst einer bedeutendsten Portugals war. Muryosa. Mit ihren breiten Hecköffnungen waren sie vermutlich Kabeljaufischer, die meistens weit im Nordatlantik und Nordpolarmeer unterwegs waren. Auch ihre Geschichte beginnt mit dem Salz, das die Lagunen im Überschuss produzierten. Das eine war: Den Fisch fangen. Das andere: ihn haltbar zu machen. Erst dann konnte man ihn zu Geld machen, indem man damit handelte. Die Geschichte des Bacalao, des gesalzenen Stockfischs, ist die, wie man nicht nur den Fang aus den Lagunen mit dem Salz konservierte, sondern immer weiter hinausfuhr, weiter und weiter. Dorthin, wo schon die Pilgerväter auf ihrer Mayflower schwärmten, dass man den Fisch mit einem Eimer aus dem Meer schöpfen konnte, so sehr wimmelte es dort. Gemeint ist der Kabeljau. Und gemeint sind die Gebiete zwischen Island und Neufundland. Aber was half es, wenn es dort Fisch im Überfluss gab, den man nur hier zu Geld machen konnte? Also nahmen sie auf ihre Fahrten Salz mit. Um den Fisch gleich an Ort und Stelle einzusalzen, haltbar zu machen. Und als Bacalao, als eingesalzenen und getrockneten Stockfisch sackweise verkaufen zu können. Die Hallen und Firmengebäude, erzählen samt der davor liegenden rottenden Schiffen, wovon die Gegend um Aveiro einst reich wurde und wovon sie heute noch lebt. Vom Fisch, der irgendwo anders gefangen und noch an Bord verarbeitet wird.

Ein stählerner Rahsegler, der an Leinen voller grünem Seetang am Ufer rostet. Was wohl seine Geschichte ist? Ob der Viermaster mal ein Passagierschiff war? Ob er auf einen findigen Unternehmer wartet, der ihn grundsaniert, Kairos tauft und für Reisen an historische Orten einsetzt? Ob er auf seine letzte Reise nach Indien zur Verschrottung wartet? Die Dinge gehen ihren Weg.
Der Fluss wird enger. Nach dem Tidenkalender müsste der Strom jetzt langsam schwächer werden. Wir haben jetzt fast Ebbe. Ich bin mit Levje allein auf dem Fluss unterwegs, am Ufer liegen die Schlickbänke vollends frei. Die Kronen der Schilfhalme rascheln im Nebel im schwachen Wind erhaben auf ihrem schlammigen Buckel. Verfallende Backsteingebäude am Ufer, Wasser, was durch ein dickes Rohr aus einem Salinengeviert in den jetzt tief liegenden Fluss herabstrudelt. Es ist gut, dass wir genau zur Ebbe vor Aveiro ankommen. Denn zwischen mir und der Stadt ist in der Seekarte eine Starkstromleitung über den Fluss eingezeichnet. Levjes Mast misst vom Wasser bis zur Spitze 16 Meter, ich weiß nicht, wie hoch die Leitung über den Fluss führt. Das fehlte jetzt noch, ein kurzer Stromschlag in Levjes Mast. Oder die heruntergerissene Stromversorgung einer Siedlung. Ich frage einen Segellehrer, der in seinem Schlauchboot die Kinder in ihren Optis auf dem Fluss begleitet, in mageren Portugiesisch, wie hoch die Leitung 100 Meter weiter flussaufwärts ist. Doch er zuckt nur die Schultern. Besser so als eine falsche Auskunft nur aus Höflichkeit, es hätte üble Folgen. Ich rufe noch mal in der Marina an. Endlich hebt jemand ab. Vivaldi heisst er. Und Vivaldi sagt, ich könne beruhigt sein: Die Leitung liefe bei Ebbe mindestens 22,50 Meter über den Fluss. Doch beruhigt bin ich noch nicht, als ich die Leitung im enger und enger werdenden Fluss erreicht habe. Von unten bin ich hilflos, kann meine Höhe vor den Leitungen nicht einschätzen, also schaue ich hinüber zu den drei Fischern am Ufer, die miteinander palavern. Ob sie gleich in Geschrei ausbrechen, weil ich den Leitungen zu nahe komme? Nein, sie schenken mir keine Beachtung. Alles frei. Ich gebe Gas. Und erreiche die Marina.
In die Stadt? Als mir Vivaldi hilft, Levje im leicht strömenden Fluss fest zu vertäuen, sagt er, es wären keine 20 Minuten entlang am Kanal und der alten Saline von Aveiro. Ob ich nur eine Nacht bleiben wolle? Er lächelt. Das würden die meisten sagen, bevor sie Aveiro gesehen hätten.

Und tatsächlich ist dieses Aveiro ein munterer Ort. Schon auf dem Kanal begegnen mir die langen, bunt bemalten Kähne, die barcos moliceiros. Früher benutzte man sie zu Ernte und Transport des Seetangs, den man als Dünger wie überall im Mittelmeer von den Sandstränden auflas und auf die Felder schaffte. Heute finden auf ihnen Ausflugsfahrten bis zur Schleuse und der dortigen Saline statt. Die Schiffe sind fast so lang wie der Kanal breit ist. Das Wenden im Kanal ist ein Kunststück, für das ich die Steuerleute bewundere wie für ihre Boote, die sie mit Liebe bemalt haben. Häufig sind sie am Bug oder am Heck mit Geschichten aus der Geschichte geschmückt, die irgendeinen Bezug haben zu jenem Ort, aus dem ihre Eigner stammen.

So wie der Bug des Kahnes, der sich O L’Ameirense nennt. Eigentlich will ich ja nur die schmucken Giebelhäuser entlang des Ufers fotografieren, die stummen Zeugen, wie sehr diesem Aveira aus Salz und Fisch, aus der Nähe von Meer und Land über viele Jahrhunderte immer wieder Wohlstand erwuchs. Aber Garantie für Wohlstand auf alle Ewigkeit war das keine. Als um 1575 herum die Mündung ins Meer – dort wo heute noch der Sandstrand in der Einfahrt ist – für ein paar Jahre verlandete, war Aveiro plötzlich abgeschnitten. Vom Meer. Aber das blieb nicht lang so.

Heute? Ist Aveiro ein geschäftiger Ort. Und nicht nur wegen des Tourismus, der sich vor allem im Zentrum der Stadt um die Kanäle herum abspielt und wo meine geliebten Sardinendosen gleich schaufensterweise nebeneinander in ihren bunten kunstreichen Verpackungen angeboten werden. Er spielt die kleinste Rolle. Nein, Aveiro geht es gut, dank Hafen, dank Firmen wie Bosch und anderen. Auch wenn das mit dem Salz und dem Fisch keine so große Rolle mehr spielt, kann es sich doch ein Fischer aus Aveiro heute leisten, seine Tage als gebräunter alternder Gigolo im schwarzen Hemd nebst Sakko und Einstecktuch auf seiner Bank vor dem Sardinen-Schaufenster zu sitzen. Und den Touristen hinter der stylischen Sonnenbrille entspannt lächelnd zuzusehen, wie sie durch sein Aveiro schwärmen.
Aber auch ich gerate ins Schwärmen. Spätestens in dem kleinen Fischlokal auf der anderen Seite des Kanals, wo mich der Kellner begeistert anschaut, als ich zwischen frittierten Scampi und frittiertem Aal mich für Letzteres entscheide. Als er mich voller Freude über meine Entscheidung aufklärt, in wievielen Gerichten seiner Küche der Aal eine Rolle spielt, ahnt er ja nicht, dass es einst die Fischer im slowenischen Isola waren, auch so einem alten Salinenort, die mich vor vielen Jahren zum gegrillten Aal bekehrten. Die frittierten kleinen Aal-Enden, die ich in der Marisqueira Mare Cheia von Aveiro bekomme: Sie sind zum eiskalten Vinho verde ein Gedicht.
Hat schon was. Dieses Aveiro. Und seine Lagunen.
Bis hin zum Singen des Windes in den Wanten und dem leichten Gluckern und Glucksen des Flusses unter Levje, während ich einschlafe.

![]()