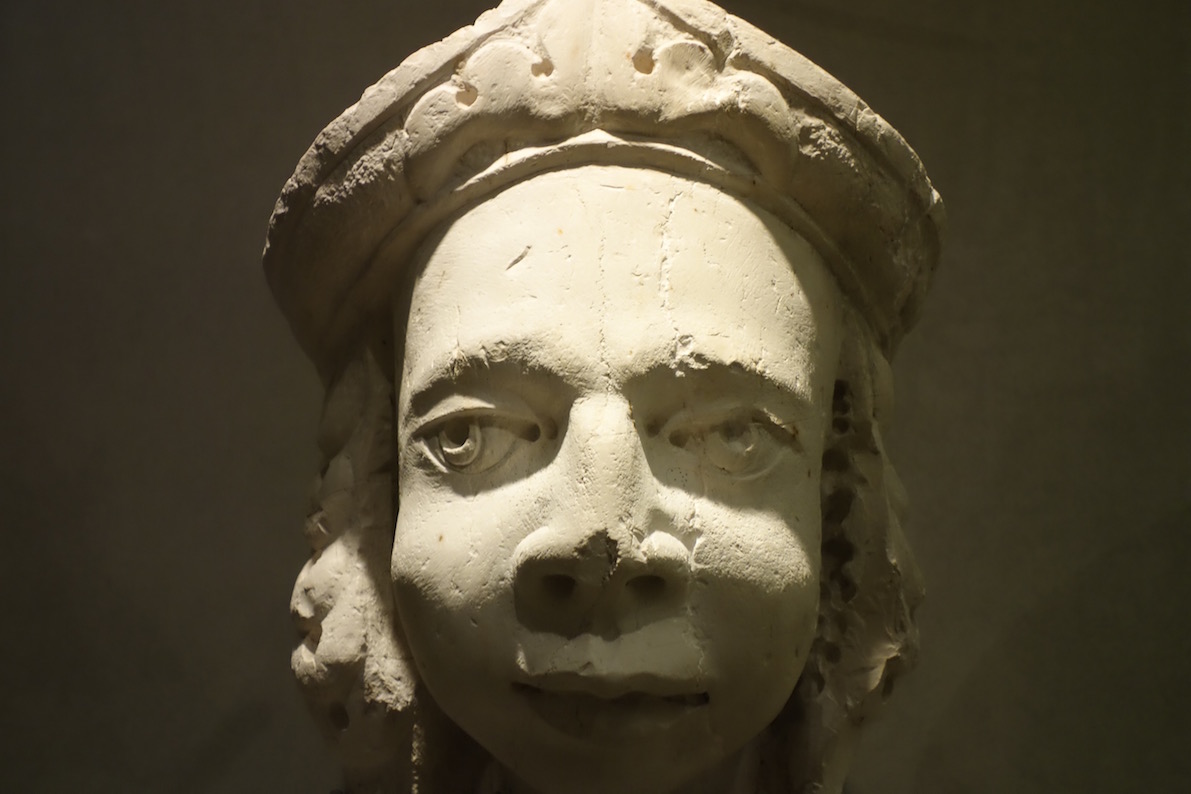Irgendwie ist es immer dasselbe: Wenn ich nach einem langen Segelschlag einen Hafen erreiche, dann freue ich mich. Doch nach zwei, drei Tagen wird mir das Liegen im Hafen zuviel. Ich will wieder hinaus, koste es, was es wolle, ich scheue keine Mühe, kein Risiko. „Du hast Angst vor Bindungen“, sagte mein Bruder einmal. Aber das traf es nicht. Meine Unrast ist etwas anderes. Es mag an meinem „Beruf“ liegen. Im Grunde genommen gibt es auf der Welt nicht mehr als knapp zwei Handvoll verschiedene Berufe. Keine zehn Berufe: Tätigkeiten, die irgendwann vor einer halben Million Jahre für das Überleben und die Fortexistenz eines umherwandernden Stammes von Bedeutung waren. Jäger. Sammler. Heiler. Lehrer. Händler. Anführer. Hand-Werker. Bauer. Die Acht. Natürlich auch in weiblicher Ausgabe. Mehr brauchte es an Berufen nicht, um die Menschheit, wie sie heute funktioniert, auf die Beine zu stellen. Und mehr Berufe gibt es wohl auch heute nicht. Denn alles andere ist nur Spielart des einen oder des anderen. IT-Expertin? Ist Hand-Werkerin – im Grunde. Journalist? Hat der Welt was zu sagen – Lehrer. Autoverkäufer? Jäger. Teamassistentin? Dahinter kann sich alles verbergen – doch irgendeiner der acht Berufe blitzt auch bei ihr im täglichen Tun durch.
Ich? Bin Händler. Eine Art übers Meer fahrender Sammler dingloser Sachen, die man Geschichten nennt. Bin ich nicht unterwegs, werde ich unleidlich. Ich schrumple innerlich wie eine Karotte, die man vergaß, in einem feuchten Tuch in den Kühlschrank zu packen. Die Welt wird mir zu eng.

Ich kann die Uhr danach stellen. Nach drei Tagen Hafen wird es mir zu eng, selbst die Aussicht, in schlimmes Wetter zu geraten, hält mich nicht fest. Ich muss raus. Ich muss die Leere da draußen sehen, wo nichts mehr ist, nur noch Wasser. Also bin ich heute morgen los. Und fahre hinüber von Ravenna. Nach Pula.
Das ist kein großer Akt. 65 Seemeilen sagt mir die elektronische Seekarte auf meinem Ipad, nicht mehr als 115 Kilometer sind es an dieser Stelle auf direktem Weg von Italien nach Kroatien. Gäbe es eine Autobahn, man bräuchte mit dem Wagen nur eineinhalb Stunden von Ravenna nach Pula. Aber es gibt sie nicht. Also werde ich erst irgendwann heute nach Mitternacht in Pula ankommen. 14 Stunden.
1. Ablegen.

Später, viel später als ich wollte, drehte ich Levjes Zündschlüssel, um den Motor zu starten. Ich liebe den Moment, wenn Levjes Motor anspringt. Ein dumpfes Grollen, wie tief im Inneren eines Berges. Ich liebe es, wenn der Motor mit unendlich langsamer Drehzahl startet, fast kann ich jede Umdrehung der Kurbelwelle mitzählen. Ich höre einen Moment zu. Dann springe ich hinunter auf die Pier. Löse die vier Leinen, die Levje gestern im Gewitterregen fest an der Pier hielten. Es ist immer ein wenig unheimliich, die Leinen seines Schiffes als Einhandsegler vom Land aus zu lösen. Schaffe ich es noch, nach dem Lösen der letzten Leine schnell hinüber auf mein Schiff zu springen? Bevor der Wind es von der Pier wegtreibt? Und der Spalt zu groß wird?
Ein Sprung hinüber. Den kurzen Moment hatte sich das Schiff schon fast einen Meter vom Ufer entfernt. Ein nettes Spiel. Ich stelle mich schnell hinters Steuerrad, und lege den Gashebel nach vorne. Der Motor verändert seine Drehzahl nicht, er klingt immer nach langsam, beruhigend, eine kraftvolles Wummern. Nur die Schraube ist jetzt eingekuppelt. Majestätisch beschleunigt das Schiff, es kostet den Motor keine Anstrengung. „Er spielt nur mit dem Schiff“, sagte mir der Mann, der das Schiff ersonnen hatte, ein eigenwilliger Techniker, der in seinem Leben mehr als 8.000 Schiffe gebaut hat, mit einem Grinsen.
Langsam gleiten wir aus dem Hafen hinaus. Knurrend treibt der Motor das Schiff behäbig an den anderen Schiffen entlang, ich genieße den Moment. Die müssen hierbleiben. Ich: Darf jetzt raus, in die Weite, alles jubelt in mir, während ich 500 an diesem Tag ungenutzte, vergessene Schiffe im Hafen zurücklasse.
Ich schalte das Funkgerät auf Kanal 16, für alle Fälle. Sollte mich jemand per Funk anpreien, dann kann ich hören. Jetzt ist das Funkgerät still. Italienisches Hafengeplapper, hin und wieder. Sonst nichts.
Ich drehe LEVJE auf einen Kurs zwischen den beiden Molenfingern ein, die spitz zulaufen, und mache mich an die Arbeit. Das Deck nach dem Ablegen klarieren. Aufräumen. Erst die fünf, sechs Leinen, die noch herumliegen, sauber in Schlingen zusammenlegen. „Eine Leine aufschießen“, heißt das im Seglerdeutsch. Dann hole ich die Fender von draußen rein: Fünf große luftgefüllte Plastikwürste, die an der Bordwand hängen und davor sorgen, dass das Boot in den Gewitterböen nicht an die Pier schlägt. Und Schaden nimmt. Während all das geschieht, werfe ich alle zehn, zwanzig Sekunden einen Blick auf LEVJEs Kurs. Sie läuft zwar unter Autopilot. Aber in der engen Gasse zwischen den Molen laufen ständig Tanker, Schlepper, Stückgutfrachter ein und aus – zu blöd, wenn ich unachtsam wäre jetzt. Auf dem Meer fühle ich mich oft als Teil einer großen Gemeinschaft, wo einer auf den anderen achtet, die Ellbogen, die man auf deutschen Autobahnen kennt, gibt es selten. Dafür ist das Meer ein zu ungewisser, unsicherer Ort. Der, den Du heute unnötig verärgerst, könnte der sein, der Dich morgen im Sturm rauszieht. Nein, achtsam bleiben, während ich Leinen und Fender an der Reling festbinde, mein Schiff, während es langsam läuft, seeklar mache.

Dann habe ich die langen Molenfinger hinter mir. Bin draußen. Optisch ist alles frei vor mir, bis auf die zehn Ölplattformen vor mir, auf die ich zuhalte, von AGOSTINO-B im Norden bis CERVIA A-K-CLUSTER. Italien betreibt sage und schreibe 135 solcher Plattformen im Meer. Hier vor Ravena, aber auch vor der Küste Siziliens. Alles sieht frei aus vor mir, auf der weiten glitzernden Fläche an diesem Morgen. Aber das ist es ganz und gar nicht. Die elektronische Seekarte sagt, dass ich mich mit LEVJE nur in bestimmten Bereichen der Wasserfläche bewegen darf. Hier ein Verkehrs-Trennungsgebiet, das Korridore für die gesamte Schiffahrt definiert, wie Ravenna angelaufen werden darf. Dort Sperrzonen um die zehn Ölplattformen herum, zwischen denen ein Kriegsschiff träge liegt wie ein dösender Wachhund. Weil sonst niemand unterwegs ist, haben die mich längst auf dem Schirm. „Also bau jetzt keinen Mist“, sage ich zu mir selber, während ich jetzt auf der elektronischen Seekarte meinen Kurs abstecke. Er sieht aus wie ein unnatürliches Zickzack nach Nordost, das ich abfahre, um alle Ge-bote und Ver-bote mit LEVJE einzuhalten.

Es kostet Mühe, den auf mich zukommenden Ölplattformen aus dem Weg zu gehen. Nein, natürlich fahre ich auf sie zu. Aber die Strömung, Windhauch, treiben mich immer näher heran, als ich will. Doch irgendwann habe ich AGOSTINO-B, die wie das Nest eines Blesshuhns auf hohen Stelzen aus dem Wasser ragt, seitlich querab. Jene AGOSTINO-B-Plattform, die vor einem Jahr italienische GREENPEACE-Aktivisten besetzten, um auf die schleichende Verseuchung des Meeresbodens um die Plattformen mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aufmerksam zu machen (Hier gehts zum Film der GREENPEACE-Aktion). AGOSTINO-B arbeitet schon ein Weilchen. Die Plattform wurde 1980 in Betrieb genommen – 47 Jahre …
Irgendwann liegt AGOSTINO-B hinter mir. Zeit, mal nach dem Motor zu sehen. Ich gehe nach unten, wo LEVJE ein großes Badezimmer mit Dusche besitze. Und öffne eine kleine Tür in der Wand. Jetzt habe ich den Motor vor mir. Er arbeitet in einer eigenen kleinen Kammer. Ich schalte das Licht an in dem kleinen Geviert. Schaue, ob der Motor irgendwo Öl verliert. Oder Kühlwasser. Lege die Hand auf die Stopfbuchse, durch die die sich drehende Welle durch den Bootskörper nach draußen geführt ist. Ob sie heiß ist. Aber alles sieht gut aus. Nichts auffälliges. Ich schließe die Wandtür.

Es ist zwölf geworden. Zeit, die Schleppangel hinten rauszuhängen, vielleicht beißt ja etwas an während der Fahrt. Und mir etwas zu Mittag etwas zu kochen: Eine Tortilla vielleicht, mit gerösteten Zwiebeln und geraspelten Zuccini. Ich lasse LEVJE einfach weiter ins grenzenlose Blau laufen, schalte den Gasherd an, setze Zwiebeln auf, hoble Parmesan und schlage Eier. Und werfe alle zwei Minuten einen Blick oben ringsum. Ob AGOSTINO-B nicht vielleicht doch auf mich zufährt. Oder der dösende Wachhund aufgewacht ist. Oder irgendwas anderes.

2. Draußen.

Sie ist kein sonderlich tiefes Meer, die Adria. Auf der gedachten Linie, auf der ich jetzt gerade unterwegs bin, 100 Kilometer südlich der Nordküste, ist die Adria gerade mal 45 Meter tief. Das ist wenig, gemesssen am Mittelmeer und seiner tiefsten Stelle mit 5.267 Metern. Jeder doofe Binnensee schafft da mehr. Der Bodensee 251 Meter. Der Starnberger See 128 Meter. Selbst der lumpige Ammersee ist fast doppelt so tief wie die Aria 100 km weit vom Nordufer entfernt. Im Grunde genommen ist die Adria eine breite, flache Senke. Eine Talsohle, die irgendwann erst spät in der Ausbildung dieses Mittelmeeres langsam voll Wasser lief, als es wärmer wurde und Gletscher und Polkappen zu schmelzen begannen und ihr Wasser die großen Ozeane füllte. Sie bleibt eine vollgelaufene Ebene, die Wassertiefe des Starnberger Sees erreicht sie erst weit im Süden, fast 300 Kilometer weiter südlich, irgendwo zwischen den Marken und der Insel Brac. Erst zwischen Albanien und Bari fällt die Adria auf 1.260 Meter Tiefe ab.
Das Flache hat sie geprägt: Im Sommer heizt das Wasser der Adria schnell auf. Und im frühen November ist es in Grado in den Lagunen schon wieder so kalt, dass Baden im Meer nur etwas für harte Burschen ist.

Ich sitze auf LEVJE an meinem Lieblingsschreibtisch, im Niedergang. Ich habe alle Instrumente vor mir: Den Geschwindigkeitsmesser, der mir sagt, wie schnell wir durchs Wasser unterwegs sind. Daneben den Tiefenmesser, der mehrmals in der Sekunden einen Laut nach unten sendet. Und anhand seines Echos errechnet, wie weit der Meeresgrund in diesem Augenblick entfernt ist. „40,3 Meter“, sagt die Anzeige. Rechts daneben der Windmesser, der den gefühlten Wind oben an der Mastspitze misst und nach unten die Windrichtung und Windstärke meldet. Rechts daneben den Radarbildschirm. Er tastet fast 50 Kilometer weit voraus den Horizont ab, ich entdecke sieben kleine gelbe Flecke. Schiffe vermutlich, denn ich bin jetzt weit draußen. 4 Seemeilen, mehr als sieben Kilometer bin ich vom nächsten Schiff entfernt. Wieder ein Stück rechts die elektronische Seekarte mit allen Daten über meinen Kurs, über meine Geschwindigkeit.
3. Die verbaute See.

Ein Kurs ist nicht immer die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Ich hatte mir in der elektronischen Seekarte als Kurs eben diese kürzeste Linie zwischen dem italienischen Ravenna und dem kroatischen Pula eingetragen. Aber der kürzeste Weg war das mitnichten.
Ich hatte vor der Abfahrt vergessen, mir meine Wegstrecke in der elektronischen Seekarte näher heranzuzoomen – ein Fehler, der im vergangenen VOLVO OCEAN-RACE eine der Rennyachten auf ein Riff mitten im nirgendwo der Ozeane führte. Mir kam kein Riff in die Quere. Sondern am späten Nachmittag, als endlich Wind aus der richtigen Richtung kam und das Meer besonders frei und grenzenlos aussah, verschiedenes in den Weg:
1. Ein großes Verkehrstrennungsgebiet.
2. Unmittelbar hinter der Grenze: Ein großes kroatische Sperrgebiet mit weiteren Ölförderplattformen.
3. Dann noch mal ein großes Verkehrstrennungsgebiet

Nix mit grenzenlos. Der kleine Fehler kostete mich zwei Stunden Umweg – ich wollte nicht riskieren, auf hoher See von einem kroatischen Wachhund zur Rede gestellt zu werden, was ich denn unter Segeln mitten im Sperrgebiet zwischen den Ölförderplattformen herumzukrauchen hätte.

Wohlgemerkt: Es gibt kein Schild, das auf so etwas aufmerksam macht. Keinen Zaun. Die Adria, das Meer sieht frei aus und grenzenlos an dieser Stelle. Sie ist es aber ganz und gar nicht.

Und wird es auch auf absehbare Zeit nicht sein. Am nächsten Tag sollte ich in Pula über dieses Schmuckstück stolpern: Die 6.815 Tonnen schwere Ölbohrplattform Labin. 1985 in Pula gebaut. Jetzt seit drei Jahren zur Reparatur in der Werft. Und dann? Wieder hinaus…
4. Die blaue Stunde.

Und irgendwann hatte ich dann das riesige Sperrgebiet hinter mir. Es war früher Abend. Und für diese Stunden liebe ich Kroatien. Die Abendstunden, in denen ein sanftes Lüftchen weht. Und eine tonnenschwere Yacht einfach nur dahingleiten, dahin schnüren lässt. Als wäre es kein totes Gewicht, sondern ein graziles Wesen, das jeden Lufthauch einfängt. Und in federleichter Bewegung und schwerelosem Schweben wie die Fallschirme des Löwenzahns im Mai durch die Elemente gleiten lässt.

5. Die Nacht.

Sie ist so ganz anders. Stunden später ist alles in tiefe Dunkelheit gehüllt. Ich höre das Brummen des Motors. Ich sehe auf der elektronischen Seekarte, dass wir unter Motor mit 7 Knoten dahinmarschieren. Sonst: Sehe ich nur die Instrumente. Vor mir: Nur Dunkelheit, bis auf beiden Richtungslichter vorne im Bug. Das rote, das grüne, die anderen Schiffen in der Dunkelheit zeigen, in welche Richtung ich mich bewege. Immer noch 40 Meter Wassertiefe, wie den ganzen Tag über schon. Ein leichter Wind von vorn. Der Rest des Abendseglers, alles, was von der Abendsegler-Brise noch übrig ist. Vor mir in der Dunkelheit die Richtungsanzeiger grün/rot.

Sonst sehe ich nichts. Nicht das Wasser, das uns trägt. Nicht die Wellen. Ich höre sie nur, ein großer Organismus, der neben LEVJE atmet. Ich sehe nur die Instrumente des Cockpits im Dämmer. Und sonst nichts.
Als ich eine Stunde später den Kopf nach draußen stecke, sind sie da: Mit einem Mal sind sie da, die Lichter am Horizont. Die Lichter der Brijuni-Inseln.
6. Der Anleger im Dunkeln.
Es ist kurz vor Mitternacht. Ich schleiche mich langsam zwischen den südlichen Brijuni Inseln hindurch. Die Seekarte gibt zuverlässig einen winkeligen Weg zwischen den Inseln hindurch vor. Hier, in den südlichen Brijuni-Inseln, ist das Ankern verboten. Naturschutzgebiet. Doch ein Stück außerhalb, nach Osten, mündet ein Fluss. Und kurz davor, auf fünf Meter Wassertiefe, liegt man geschützt für Bora und Yugo. Rumpelt fällt der Anker in die Tiefe. Noch einmal kurz daran ziehen und mit Maschine langsam rückwärts. Ob er auch wirklich hält. Dann Motor aus.
Stille.
Was für ein Tag.
Hardfacts:
Was braucht man, um mal eben schnell
die Adriaseite zu wechseln?
1 seetüchtiges Boot, möglichst mit Motor und ausreichend Sprit.
1 guter Wetterbericht
… in dieser Reihenfolge:
Meteomar (Kanal 68) der italienischen Luftwaffe
Seewetteramt Split
Windyty.com/Windguru.cz
1 gute Seekarte.
… und die Lust auf 14 Stunden Einsamkeit auf dem Meer.
… und wem 14 Stunden Einsamkeit zu wenig
und sechs Monate allein auf See immer noch nicht genug ist:

Wer reinschnuppern will:
Das Buch ist bei AMAZON und anderen erhältlich.
Es hat 320 Seiten und etwa 100 Fotos und noch mehr Links.
Und wer mehr darüber erfahren will: Hier sind alle Links: auf www.millemari.de.
Oder direkt zu AMAZON: Hier.